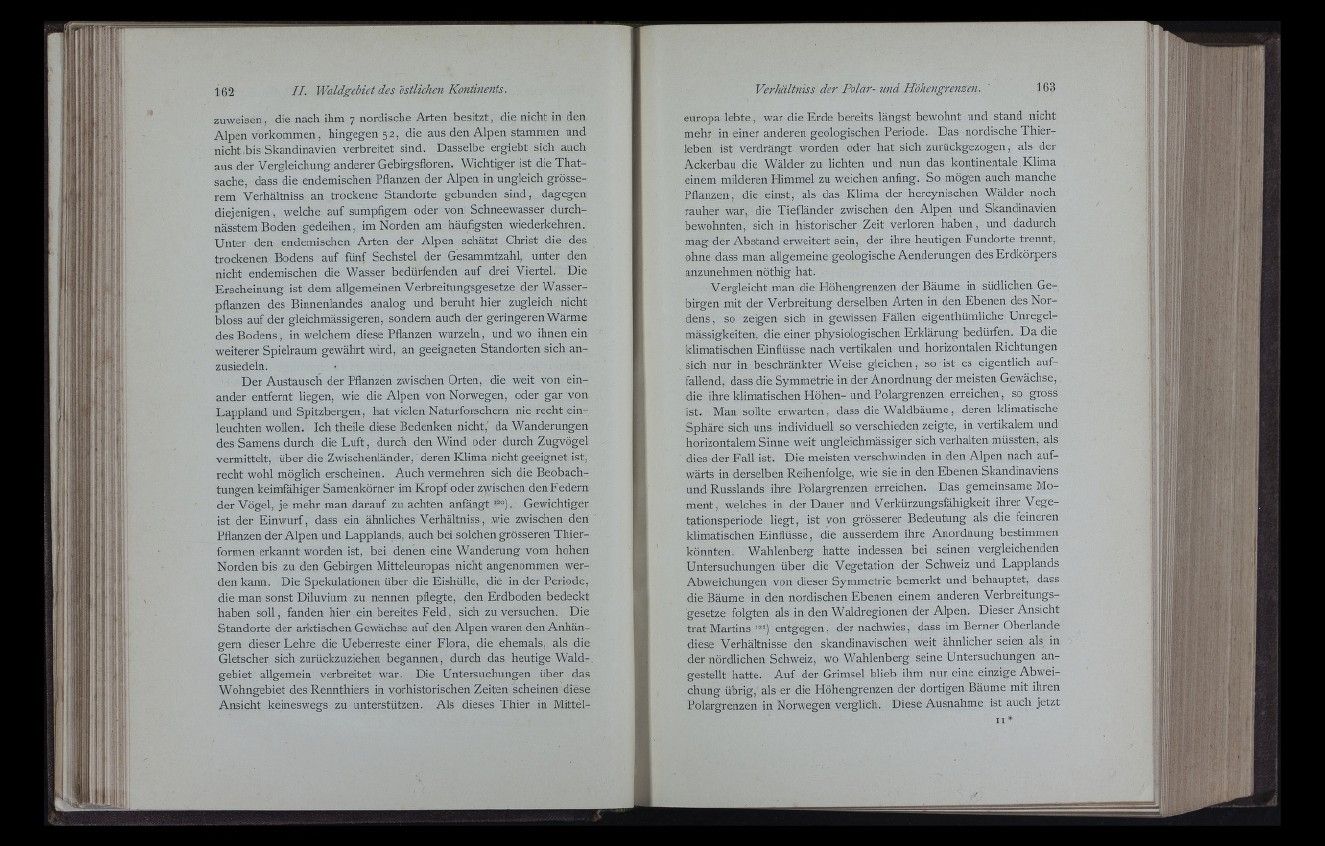
zuweisen, die nach ihm 7 nordische Arten besitzt, die nicht in den
Alpen Vorkommen, hingegen 52, die aus den Alpen stammen und
nicht bis Skandinavien verbreitet sind. Dasselbe ergiebt sich auch
aus der Vergleichung anderer Gebirgsfloren. Wichtiger ist die That-
sache, dass die endemischen Pflanzen der Alpen in ungleich grösserem
Verhältniss an trockene Standorte gebunden sind, dagegen
diejenigen, welche auf sumpfigem oder von Schneewasser durchnässtem
Boden gedeihen, im Norden am häufigsten wiederkehren.
Unter den endemischen Arten der Alpen schätzt Christ die des
trockenen Bodens auf fünf Sechstel der Gesammtzahl, unter den
nicht endemischen die Wasser bedürfenden auf drei Viertel. Die
Erscheinung ist dem allgemeinen Verbreitungsgesetze der Wasserpflanzen
des Binnenlandes analog und beruht hier zugleich nicht
bloss auf der gleichmässigeren, sondern auch der geringeren Wärme
des Bodens, in welchem diese Pflanzen wurzeln, und wo ihnen ein
weiterer Spielraum gewährt wird, an geeigneten Standorten sich anzusiedeln.
Der Austausch der Pflanzen zwischen Orten, die weit von einander
entfernt liegen, wie die Alpen von Norwegen, oder gar von
Lappland und Spitzbergen, hat vielen Naturforschern nie recht einleuchten
wollen. Ich theile diese Bedenken nicht, da Wanderungen
des Samens durch die Luft, durch den Wind oder durch Zugvögel
vermittelt, über die Zwischenländer, deren Klima nicht geeignet ist,
recht wohl möglich erscheinen. Auch vermehren sich die Beobachtungen
keimfähiger Samenkörner im Kropf oder zwischen den Federn
der Vögel, je mehr man darauf zu achten anfängt I2°). Gewichtiger
ist der Einwurf, dass ein ähnliches Verhältniss, wie zwischen den
Pflanzen der Alpen und Lapplands, auch bei solchen grösseren Thierformen
erkannt worden ist, bei denen eine Wanderung vom hohen
Norden bis zu den Gebirgen Mitteleuropas nicht angenommen werden
kann. Die Spekulationen über die Eishülle, die in der Periode,
die man sonst Diluvium zu nennen pflegte, den Erdboden bedeckt
haben soll, fanden hier ein bereites Feld, sich zu versuchen. Die
Standorte der arktischen Gewächse auf den Alpen waren den Anhängern
dieser Lehre die Ueberreste einer Flora, die ehemals, als die
Gletscher sich zurückzuziehen begannen, durch das heutige Waldgebiet
allgemein verbreitet war. Die Untersuchungen über das
Wohngebiet des Rennthiers in vorhistorischen Zeiten scheinen diese
Ansicht keineswegs zu unterstützen. Als dieses Thier in Mitteleuropa
lebte, war die Erde bereits längst bewohnt und stand nicht
mehr in einer anderen geologischen Periode. Das nordische Thierleben
ist verdrängt worden oder hat sich zurückgezogen, als der
Ackerbau die Wälder zu lichten und nun das kontinentale Klima
einem milderen Himmel zu weichen anfing. So mögen auch manche
Pflanzen, die einst, als das Klima der hercynischen Wälder noch
rauher war, die Tiefländer zwischen den Alpen und Skandinavien
bewohnten, sich in historischer Zeit verloren haben, und dadurch
mag der Abstand erweitert sein, der ihre heutigen Pundorte trennt,
ohne dass man allgemeine geologische Aenderungen des Erdkörpers
anzunehmen nöthig hat.
Vergleicht man die Höhengrenzen der Bäume in südlichen Gebirgen
mit der Verbreitung derselben Arten in den Ebenen des Nordens
, so zeigen sich in gewissen Fällen eigenthümliche Unregelmässigkeiten,
die einer physiologischen Erklärung bedürfen. Da die
klimatischen Einflüsse nach vertikalen und horizontalen Richtungen
sich nur in beschränkter Weise gleichen, so ist es eigentlich auffallend,
dass die Symmetrie in der Anordnung der meisten Gewächse,
die ihre klimatischen Höhen- und Polargrenzen erreichen, so gross
ist. Man sollte erwarten, dass die Waldbäume, deren klimatische
Sphäre sich uns individuell so verschieden zeigte, in vertikalem und
horizontalem Sinne weit ungleichmässiger sich verhalten müssten, als
dies der Fall ist. Die meisten verschwinden in den Alpen nach aufwärts
in derselben Reihenfolge, wie sie in den Ebenen Skandinaviens
und Russlands ihre Polargrenzen erreichen. Das gemeinsame Moment
, welches in der Dauer und Verkürzungsfähigkeit ihrer Vegetationsperiode
liegt, ist von grösserer Bedeutung als die feineren
klimatischen Einflüsse, die ausserdem ihre Anordnung bestimmen
könnten. Wahlenberg hatte indessen bei seinen vergleichenden
Untersuchungen über die Vegetation der Schweiz und Lapplands
Abweichungen von dieser Symmetrie bemerkt und behauptet, dass
die Bäume in den nordischen Ebenen einem anderen Verbreitungs-
gesetze folgten als in den Waldregionen der Alpen. Dieser Ansicht
trat Martins I21) entgegen, der nachwies, dass im Berner Oberlande
diese Verhältnisse den skandinavischen weit ähnlicher seien als in
der nördlichen Schweiz, wo Wahlenberg seine Untersuchungen angestellt
hatte. Auf der Grimsel blieb ihm nur eine einzige Abweichung
übrig, als er die Höhengrenzen der dortigen Bäume mit ihren
Polargrenzen in Norwegen verglich. Diese Ausnahme ist auch jetzt
11 *