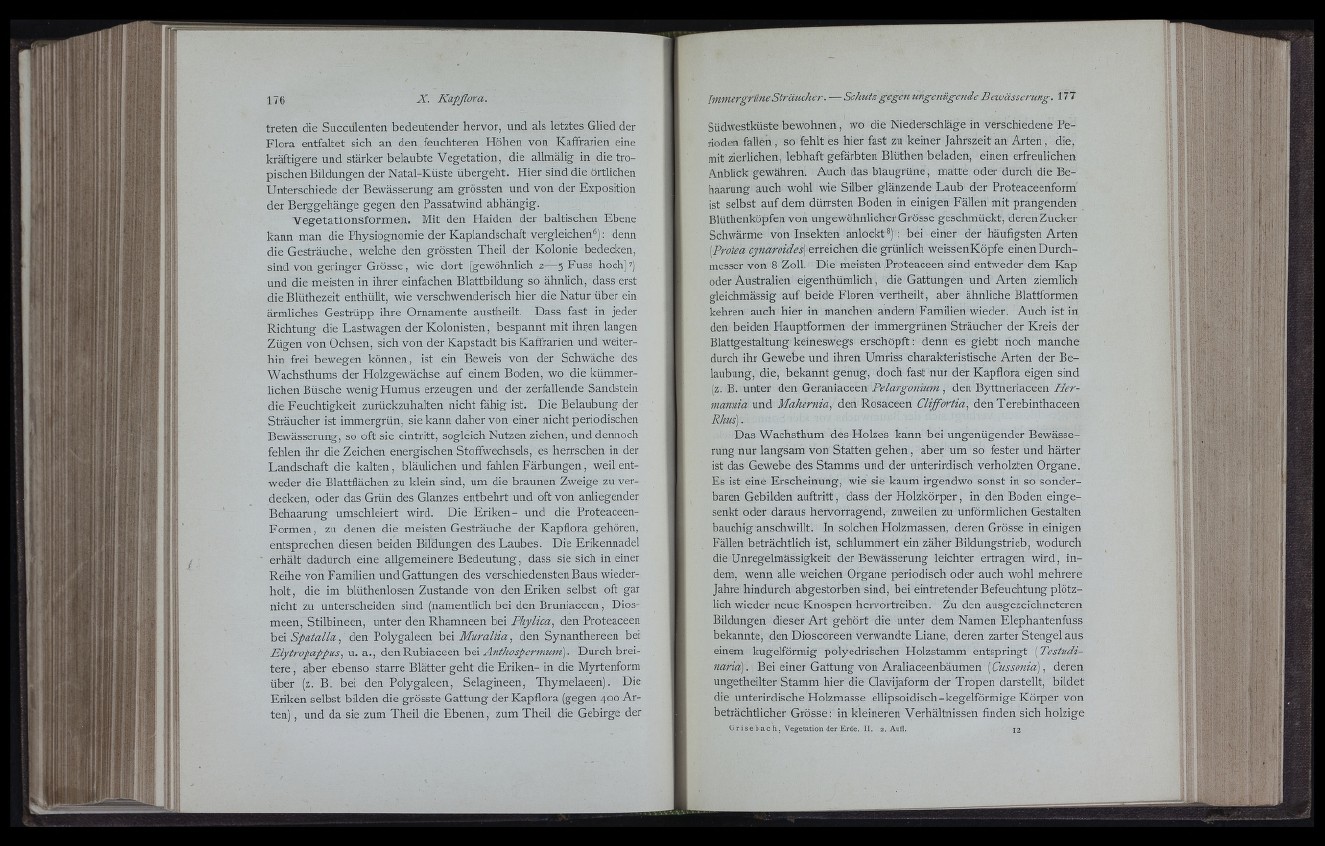
treten die Succülenten bedeutender hervor, und als letztes Glied der
Flora entfaltet sich an den feuchteren Höhen von Kaffrarien eine
kräftigere und stärker belaubte Vegetation, die allmälig in die tropischen
Bildungen der Natal-Küste übergeht. Hier sind die örtlichen
Unterschiede der Bewässerung am grössten und von der Exposition
der Berggehänge gegen den Passatwind abhängig.
Vegetationsformen. Mit den Haiden der baltischen Ebene
kann man die Physiognomie der Kaplandschaft vergleichen6): denn
die Gesträuche, welche den grössten Theil der Kolonie bedecken,
sind von geringer Grösse, wie dort [gewöhnlich 2—5 Fuss hoch]?)
und die meisten in ihrer einfachen Blattbildung so ähnlich, dass erst
die Bliithezeit enthüllt, wie verschwenderisch hier die Natur über ein
ärmliches Gestrüpp ihre Ornamente austheilt. Dass fast in jeder
Richtung die Lastwagen der Kolonisten, bespannt mit ihren langen
Zügen von Ochsen, sich von der Kapstadt bis Kaffrarien und weiterhin
frei bewegen können, ist ein Beweis von der Schwäche des
Wachsthums der Holzgewächse auf einem Boden, wo die kümmerlichen
Büsche wenig Humus erzeugen und der zerfallende Sandstein
die Feuchtigkeit zurückzuhalten nicht fähig ist. Die Belaubung der
Sträucher ist immergrün, sie kann daher von einer nicht periodischen
Bewässerung, so oft sie eintritt, sogleich Nutzen ziehen, und dennoch
fehlen ihr die Zeichen energischen Stoffwechsels, es herrschen in der
Landschaft die kalten, bläulichen und fahlen Färbungen, weil entweder
die Blattflächen zu klein sind, um die braunen Zweige zu verdecken,
oder das Grün des Glanzes entbehrt und oft von anliegender
Behaarung umschleiert wird. Die Eriken- und die Proteaceen-
Formen, zu denen die meisten Gesträuche der Kapflora gehören,
entsprechen diesen beiden Bildungen des Laubes. Die Erikennadel
erhält dadurch eine allgemeinere Bedeutung, dass sie sich in einer
Reihe von Familien und Gattungen des verschiedensten Baus wiederholt
, die im blüthenlosen Zustande von den Eriken selbst oft gar
nicht zu unterscheiden sind (namentlich bei den Bruniaceen, Dios-
meen, Stilbineen, unter den Rhamneen bei Phylica, den Proteaceen
bei Spatalla, den Polygaleen bei Muraltia, den Synanthereen bei
Elytropcippus, u. a., den Rubiaceen bei Anthospermum). Durch breitere
, aber ebenso starre Blätter geht die Eriken- in die Myrtenform
über (z. B. bei den Polygaleen, Selagineen, Thymelaeen). Die
Eriken selbst bilden die grösste Gattung der Kapflora (gegen 400 Arten)
, und da sie zum Theil die Ebenen, zum Theil die Gebirge der
Südwestküste bewohnen, wo die Niederschläge in verschiedene Perioden
fallen, so fehlt es hier fast zu keiner Jahrszeit an Arten , die,
mit zierlichen, lebhaft gefärbten Blüthen beladen, einen erfreulichen
Anblick gewähren. Auch das blaugrüne, matte oder durch die Behaarung
auch wohl wie Silber glänzende Laub der Proteaceenform
ist selbst auf dem dürrsten Boden in einigen Fällen mit prangenden
Bliithenköpfen von ungewöhnlicher Grösse geschmückt, deren Zucker
Schwärme von Insekten anlockt8) : bei einer der häufigsten Arten
[Protea cynaroides) erreichen die grünlich weissenKöpfe einen Durchmesser
von 8 Zoll. Die meisten Proteaceen sind entweder dem Kap
oder Australien eigenthümlich, die Gattungen und Arten ziemlich
gleichmässig auf beide Floren vertheilt, aber ähnliche Blattformen
kehren auch hier in manchen andern Familien wieder. Auch ist in
den beiden Hauptformen der immergrünen Sträucher der Kreis der
Blattgestaltung keineswegs erschöpft: denn es giebt noch manche
durch ihr Gewebe und ihren Umriss charakteristische Arten der Belaubung,
die, bekannt genug, doch fast nur der Kapflora eigen sind
(z. B. unter den Geraniaceen Pelargonium, den Byttneriaceen Her-
mannia und Mahernia, den Rosaceen Clijfortia, den Terebinthaceen
Ritus).
Das Wachsthum des Holzes kann bei ungenügender Bewässerung
nur langsam von Statten gehen, aber um so fester und härter
ist das Gewebe des Stamms und der unterirdisch verholzten Organe.
Es ist eine Erscheinung, wie sie kaum irgendwo sonst in so sonderbaren
Gebilden auftritt, dass der Holzkörper, in den Boden eingesenkt
oder daraus hervorragend, zuweilen zu unförmlichen Gestalten
bauchig anschwillt. In solchen Holzmassen, deren Grösse in einigen
Fällen beträchtlich ist, schlummert ein zäher Bildungstrieb, wodurch
die Unregelmässigkeit der Bewässerung leichter ertragen wird, indem,
wenn alle weichen Organe periodisch oder auch wohl mehrere
Jahre hindurch abgestorben sind, bei eintretender Befeuchtung plötzlich
wieder neue Knospen hervortreiben. Zu den ausgezeichneteren
Bildungen dieser Art gehört die unter dem Namen Elephantenfuss
bekannte, den Dioscoreen verwandte Liane, deren zarter Stengel aus
einem kugelförmig polyedrischen Holzstamm entspringt (Testudi-
narici). Bei einer Gattung von Araliaceenbäumen (Cussonia), deren
ungetheilter Stamm hier die Clavijaform der Tropen darstellt, bildet
die unterirdische Holzmasse ellipsoidisch-kegelförmige Körper von
beträchtlicher Grösse: in kleineren Verhältnissen finden sich holzige
Gr i s eba c h . Vegetation der Erde. II. 2. Aufl.