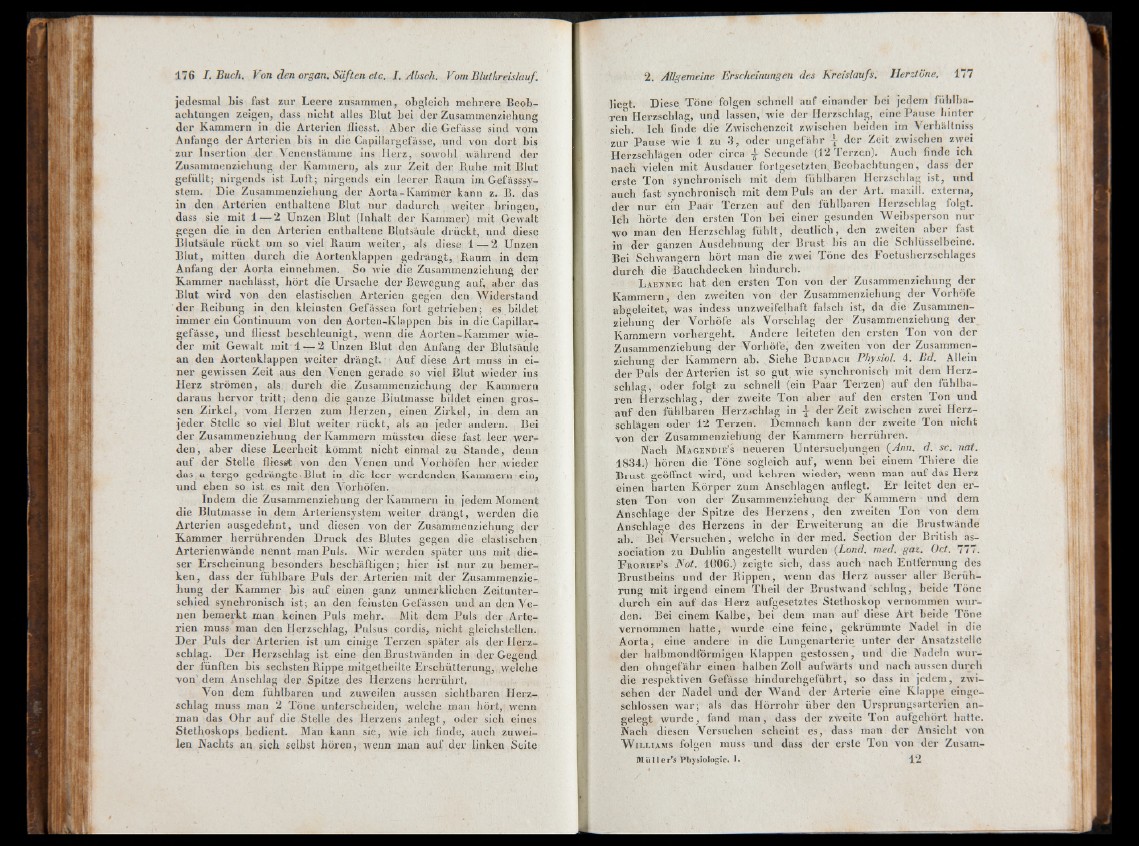
jedesmal bis fast zur Leere zusammen, obgleich mehrere Beobachtungen
zeigen, dass nicht alles Blut bei der Zusammenziehüng
der Kammern in die Arterien fliesst. Aber die Gefässe sind vom
Anfänge der Arterien bis in die Capiilargefässe, und von dort bis
zur Insertion der Venenstämme ins Herz, sowohl wahrend der
Zusammenziehung der Kammern, als zur Zeit der Ruhe mit Blut
gefüllt; nirgends ist Luft; nirgends ein leerer Raum iin Gefässsy-
stem. Die Zusammenziehung der Aorta -Karrfmer kann z. B. das
in den Arterien enthaltene Blut nur dadurch weiter bringen,
dass sie mit 1 — 2 Unzen Blut (Inhalt der Kammer) mit Gewalt
gegen die in den Arterien enthaltene Blutsäule drückt, und diese
Blutsäule rückt um so viel Raum weiter,, als diese 1 — 2 Unzen
Blut, mitten durch die Aortenklappen gedrängt, Raum in dem
Anfang der Aorta einnehmen. So wie die Zusammenziehung der
Kammer nachlässt, hört die Ursache der Bewegung auf, aber das
Blut wird von den elastischen Arterien gegen den Widerstand
der Reibung in den kleinsten Gefässen fort getrieben; es bildet
immer ein Continuum von den Aorten-Klappen bis in die Cjapillar-
gefässe, und fliesst beschleunigt, wenn die Aorten-Kammer wieder
mit Gewalt mit T— 2 Unzen Blut den Anfang der Blutsäule,
an den Aortenklappen weiter drängt. Auf diese Art muss in einer
gewissen Zeit aus den Venen gerade so viel Blut wieder ins
Herz strömen, als durch die Zusammenziehung der Kammern
daraus hervor tritt; denn die ganze Biutmasse bildet einen grossen
Zirkel, vom Herzen zum Herzen, einen Zirkel, in dem an
jeder Stelle so viel Blut weiter rückt, als an jeder andern. Bel
der Zusammenziehung der Kammern müsste») diese fast leer werden,
aber diese Leerheit kömmt nicht einmal zu Stande, denn
auf der Stelle fliesst von den Venen und Vorhöfen her wieder
das a tergo gedrängte-Blut in die leer werdenden Kammern ein,
und eben so ist es mit den Vorhöfen.
Indem die Zusammenziehung der Kammern in jedem Moment
die Blutmasse in dem Arteriensystem weiter drängt, werden die
Arterien ausgedehnt, und diesen von der Zusammenziehung der
Kammer herrührenden Druck des Blutes gegen die elastischen
Arterienwände nennt man Puls. Wir werden später uns mit dieser
Erscheinung besonders beschäftigen; hier ist nur zu bemerken,
dass der fühlbare Puls der, Arterien mit der Zusammenzie-,
hung der Kammer bis auf einen ganz unmerklichen Zeitunterschied
synchronisch ist; an den feinsten Gefässen und an den Venen
bemerkt man keinen Puls mehr. Mit dem Puls der Arterien
muss man den Herzschlag, Pulsus cordis, nicht gleichstellen.
Der Puls der Arterien ist um einige Terzen später als der Herzschlag.
Der Herzschlag ist eine den Brustwänden in der Gegend
der fünften bis sechsten Rippe mitgetheilte Erschütterung, welche
von' dem Anschlag der Spitze des Herzens herrührt,
Von dem fühlbaren und zuweilen aussen sichtbaren Herzschlag
muss man 2 Töne unterscheiden, welche man hört, wenn
man das Ohr auf die Stelle des Herzeris anlegt, oder sich eines
Stethoskops bedient. Man kann sie, wie ich finde, auch zuweilen
Nachts an sich selbst hören, wenn man auf der linken Seite
liegt. Diese Töne folgen schnell auf einander bei jedem fühlbaren
Herzschlag, und lassen, wie der Herzschlag, eine Pause hinter
sich. Ich finde die Zwischenzeit zwischen beiden im Verhältniss
zur Pause wie 1 zu 3, oder ungefähr i der Zeit zwischen zwei
Herzschlägen oder circa -g- Secunde (12 Terzen). Auch finde ich
nach vielen mit Ausdauer fortgesetzten. Beobachtungen, dass der
erste Ton synchronisch mit dem fühlbaren Herzschlag ist, und
auch fast synchronisch mit dem Puls an der Art. maxill. externa,
der nur ein Paär Terzen auf den fühlbaren Herzschlag folgt.
Ich hörte den ersten Ton bei einer gesunden Weibsperson nur
wo man den Herzschlag fühlt, deutlich, den zweiten aber fast
in der ganzen Ausdehnung der Brust bis an die Schlüsselbeine.
Bei Schwängern hört man die zwei Töne des Foetusherzschlages
durch die Bauchdecken hindurch.
L aennec hat den ersten Ton von der Zusammenziehung der
Kammern, den zweiten von der Zusammenziehung der Vorhöfe
abgeleitet, was indess unzweifelhaft falsch ist, da die Zusammenziehung
der Vorhöfe als Vorschlag der Zusammenziehung der
Kammern vorhergeht. Andere leiteten den ersten Ton von der
Zusammenziehung der Vorhöfe, den zweiten von der Zusammenziehung
der Kammern ab. Siehe Bübdach Physiol. 4. Bd. Allein
der Puls der Arterien ist so gut wie synchronisch mit dem Herzschlag,
oder folgt zu schnell (ein Paar Terzen) auf den fühlbaren
Herzschlag, der zweite Ton aber auf den ersten Ton und
auf den fühlbaren Herzschlag in \ der Zeit zwischen zwei Herzschlägen
oder 12 Terzen. Demnach kann der zweite Ton nicht
von der Zusammenziehung der Kammern herrühren.
Nach Magendie’s neueren Untersuchungen (Arm. d. sc. nat.
1834.) hören die Töne sogleich auf, wenn bei einem Tliiere die
Brust geöffnet wird, und kehren wieder, wenn man auf das Herz
einen harten Körper zum Anschlägen auflegt. Er leitet den ersten
Ton von der Zusammenziehung der Kammern und dem
Anschläge der Spitze des Herzens, den zweiten Ton von dem
Anschläge des Herzens in der Erweiterung an die Brustwände
ab. Bei Versuchen, welche in der med. Section der British as-
sociation zu Dublin angestellt wurden [Lond. med, gaz. Oct. 777.
F boriep’s Not. 1006.) zeigte sich, dass auch nach Entfernung des
Brustbeins und der Kippen, wenn das Herz ausser aller Berührung
mit irgend einem Theil der Brustwand schlug, beide Töne
durch ein auf das Herz aufgesetztes Stethoskop vernommen wurden.
Bei einem Kalbe, bei dem man auf diese Art beide Töne
vernommen hatte, wurde eine feine, gekrümmte Nadel in die
Aorta, eine andere in die Lungenarterie unter der Ansatzstelle
der halbmondförmigen Klappen gestossen, und die Nadeln wurden
ohngef ähr einen halben Zoll aufwärts und nach aussen durch
die respektiyen Gefässe hindurchgeführt, so dass in jedem, zwischen
der Nadel und der Wand der Arterie eine Klappe eingeschlossen
-vyar; als das Hörrohr über den Ursprungsarterien angelegt
wurde, fand man, dass der zweite Ton aufgehört hatte.
Nach diesen Versuchen scheint es, dass man der Ansicht von
"Williams folgen muss und dass der erste Ton von der Zusam-
M ii 11 erTS Physiologie. I. 12