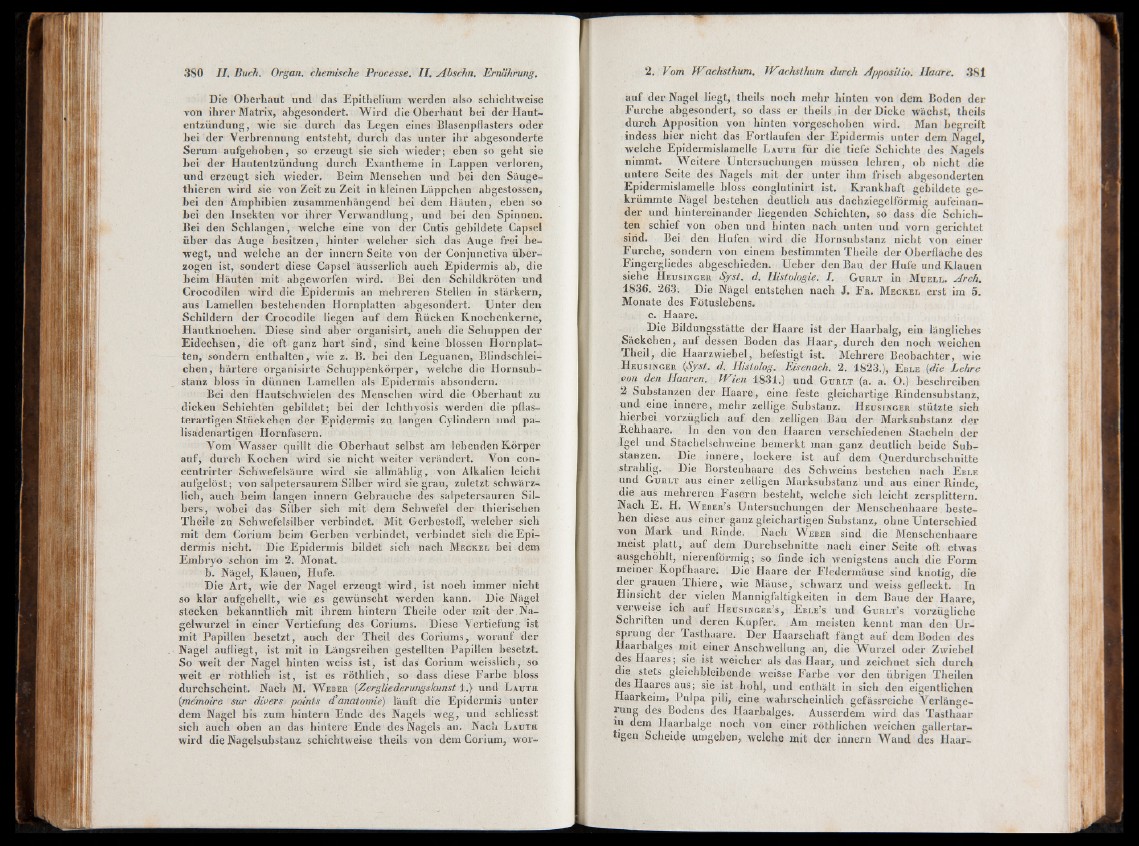
Die Oberhaut und das Epithelium werden also schichtweise
von ihrer Matrix, abgesondert. Wird die Oberhaut bei der Hautentzündung,
wie sie durch das Legen eines Blasenpflasters oder
bei der Verbrennung entsteht, durch das unter ihr abgesonderte
Serum aufgehoben, so erzeugt sie sich wieder; eben so geht sie
bei der Hautentzündung durch Exantheme in Lappen verloren,
und erzeugt sich wieder. Beim Menschen und bei den Säuge-
thieren wird sie von Zeit zu Zeit in kleinen Läppchen abgestossen,
bei den Amphibien zusammenhängend bei dem Häuten, eben so
bei den Insekten vor ihrer Verwandlung, und bei den Spinnen.
Bei den Schlangen ,- welche eine von der Cutis gebildete Capsel
über das Auge besitzen, hinter welcher sich das Auge frei bewegt,
und welche an der innern Seite von der Conjunctiva überzogen
ist, sondert diese Capsel äusserlich auch Epidermis ab, die
beim Häuten mit abgeworfen wird. Bei den Schildkröten und
Crocodilen wird die Epidermis an mehreren Stellen in stärkern,
aus Lamellen bestehenden Hornplatten abgesondert. Unter den
Schildern der Crocodile liegen auf dem Rücken Knochénkerne,
Hautknochen. Diese sind aber organisirt, auch die Schuppen der
Eidechsen, die oft ganz hart sind, sind keine blossen Hornplatten,
sondern enthalten, wie z. B. bei den Leguanen, Blindschleichen,
härtere organisirte Schuppenkörper, welche die Hornsubstanz
bloss in dünnen Lamellen als Epidermis absondern.
Bei den Hautschwielen des Menschen wird die Oberhaut zu
dicken Schichten gebildet; bèi der Ichtbyosis werden die pflasterartigen
Stückchen der Epidermis zu langen Cylindern und palisadenartigen
Hornfasern.
Vom Wasser quillt die Oberhaut selbst am lebenden Körper
auf, durch Kochen wird sie nicht weiter verändert. Von con-
centrirter Schwefelsäure wird sie allmählig, von Alkalien leicht
aufgelöst; von salpetersaurem Silber wird sie grau, zuletzt schwärzlich,
auchJbeim langen innern Gebrauche des salpetersauren Silbers,
wobei das Silber sich mit dem Schwefel der thierischen
Theile zu Schwefelsilber verbindet. Mit Gerbestoff, welcher sich
mit dem Corium beim Gerben verbindet, verbindet sich die Epidermis
nicht. Die Epidermis bildet sich nach Meckel bei dem
Embryo schon im 2. Monat.
b. Nägel, Klauen, Hufe.
Die Art, wie dér Nagel erzeugt wird, ist noch immer nicht
so klar aufgehellt, wie cs gewünscht werden kann. Die Nägel
stecken bekanntlich mit ihrem hintern Theile oder mit der. Nagelwurzel
in einer Vertiefung des Coriums. Diese Vertiefung ist
mit Papillen besetzt, auch der Theil des Coriums, worauf der
Nagel aufliegt, ist mit in Längsreihen gestellten Papillen besetzt.
So weit der Nagel hinten weiss ist, ist das Corium weisslich, so
weit er röthlich ist, ist es röthlich, so dass diese Farbe bloss
durchscheint. Nach M. W eber (Zergliederungskunst 1.) und L auth
(memoire sw divers poinis d’anatomie) läuft die Epidermis unter
dem Nagel bis zum hintern Ende des Nagels weg, und schliesst
sich auch oben an das hintere Ende des Nagels an. Nach L auth
wird die Nagelsubstanz schichtweise theiis von dem Corium, worauf
der Nagel liegt, theiis noch mehr hinten von dem Boden der
Furche abgesondert, so dass er theiis in der Dicke wächst, theiis
durch Apposition von hinten vorgeschoben wird. Man begreift
indess hier nicht das Fortlaufen der Epidermis unter dem Nagel,
welche Epidermislamelle L auth für die tiefe Schichte des Nagels
nimmt. Weitere Untersuchungen müssen lehren, ob nicht die
untere Seite des Nagels mit der unter ihm frisch abgesonderten
Epidermislamelle bloss conglutinirt ist. Krankhaft gebildete gekrümmte
Nägel bestehen deutlich aus dachziegelförmig aufeinander
und hintereinander liegenden Schichten, so dass die Schichten
schief von oben und hinten nach unten und vorn gerichtet
sind. Bei den Hufen wird die Hornsubstanz nicht von einer
Furche, sondern von einem bestimmten Theile der Oberfläche des
Fingergliedes abgeschieden. Ueber den Bau der Hufe und Klauen
siebe H eusinger Syst. d. Histologie. I. Gurlt in Muell. Arch.
1836. 263; Die Nägel entstehen nach J. F r. Meckel erst im 5.
Monate des Fötuslebens.
c. Haare.
Die Bildungsstätte der Haare ist der Haarbalg, ein längliches
Säckchen, auf dessen Boden das Haar, durch den noch weichen
Theil, die Haarzwiebel, befestigt ist. Mehrere Beobachter, wie
H eusinger {Syst. d. Histolog. Eisenach. 2. 1823.), E ble {die Lehre
von den Haaren. Wien 1831.) und Gurlt (a. a. O.) beschreiben
2 Substanzen der Haare, eine feste gleichartige Rindensubstanz,
und eine innere, mehr zellige Substanz. H eusinger stützte sich
hierbei vorzüglich auf den zeitigen Bau der Marksubstanz der
Rehhaare. In den von den Haaren verschiedenen Stacheln der
Igel und Stachelschweine bemerkt man ganz deutlich beide Substanzen.
Die innere, lockere ist auf dem Querdurchschnitte
strahlig. Die Borstenhaare des Schweins bestehen nach E ble
und Gurlt aus einer zeitigen Marksubstanz und aus einer Rinde,
die aus mehreren Fasern besteht, welche sich leicht zersplittern.
Nach E. H. W eber’s Untersuchungen der Menschenhaare bestehen
diese aus einer ganz gleichartigen Substanz, ohne Unterschied
von Mark und Rinde. Nach W eber sind die Menschenhaare
meist platt, auf dem Durchschnitte nach einer Seite oft etwas
ausgehöhlt, nierenförmig; so finde ich wenigstens auch die Form
meiner Kopfhaare. Die Haare der Fledermäuse sind knotig, die
der grauen Thiere, wie Mäuse, schwarz und weiss gefleckt. In
Hinsicht der vielen Mannigfaltigkeiten in dem Baue der Haare,
verweise ich auf H eusinger’s , E ble’s und Gurlt’s vorzügliche
Schriften und deren Kupfer. Am meisten kennt man den Ursprung
der Tasthaare. Der Haarschaft fängt auf dem Boden des
Haarbalges mit einer Anschwellung an, die "Wurzel oder Zwiebel
des Haares; sie ist weicher als das Haar, und zeichnet sich durch
die stets gleichbleibende weisse Farbe vor den übrigen Theilen
des Haares aus; sie ist hohl, und enthält in sich den eigentlichen
Haarkeim, Pulpa pili, eine wahrscheinlich gefässreiche Verlängerung
des Bodens des Haarbalges. Ausserdem wird das Tasthaar
in dem Haarbalge noch von einer röthlichen weichen gallertartigen
Scheide umgeben, welche mit der innern Wand des Haar