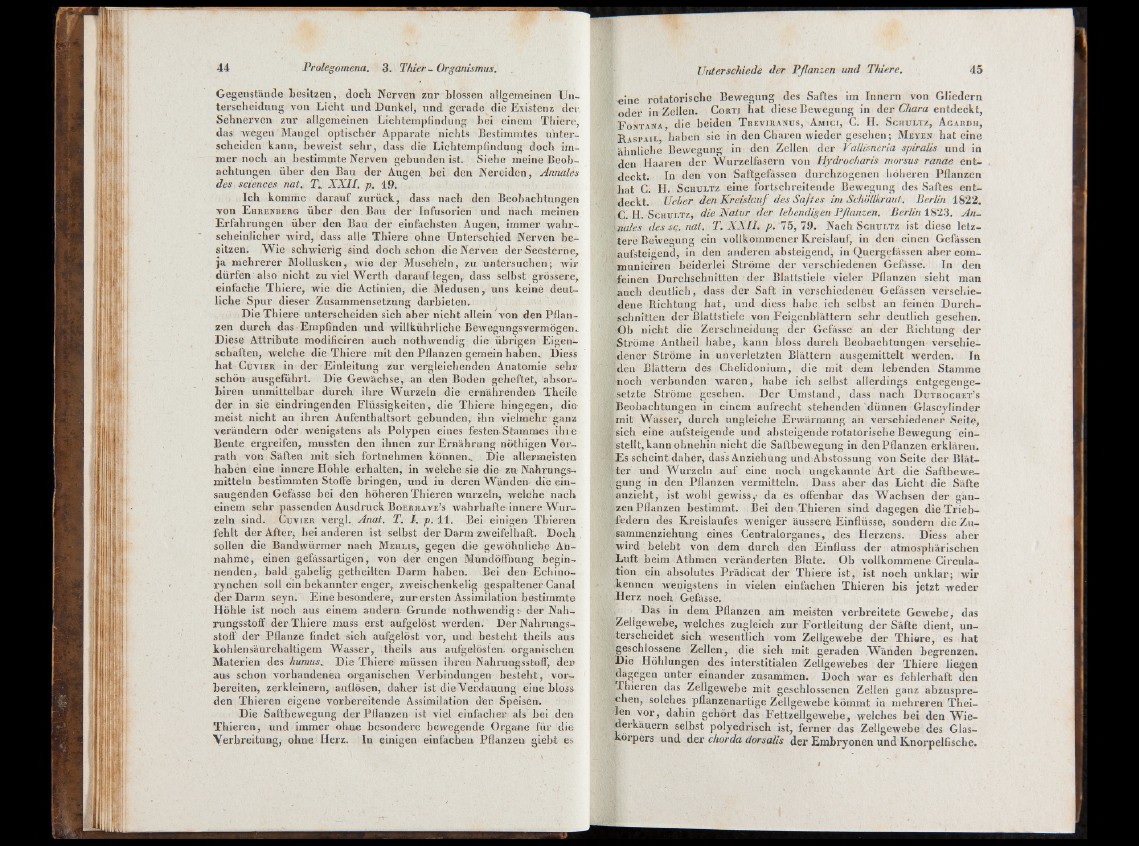
Gegenstände besitzen, doch. Nerven zur blossen allgemeinen Unterscheidung
von Licht und Dunkel, und gerade die Existenz der
Sehnerven zur allgemeinen Lichtempfindung bei einem Thiere,
das xvegert Mangel optischer Apparate nichts Bestimmtes unterscheiden
kann, beweist sehr, dass die Lichtempfindung doch immer
noch an bestimmte Nerven gebunden ist. Siehe meine Beobachtungen
über den Bau der Augen bei den Nereiden, Annales
des Sciences nat. T_ XXII. p. 19.
Ich komme darauf zurück, dass nach den Beobachtungen
von E hrenberg über den. Bau der Infusorien und nach meinen
Erfahrungen über den Bau der einfachsten Augen, immer wahrscheinlicher
wird, dass alle Thiere ohne Unterschied Nerven besitzen.
Wie schwierig sind doch schon die Nerven der Seesterne,
ja mehrerer Mollusken, wie der Muscheln, zu untersuchen; wir
dürfen also nicht zu viel Werth darauf legen,, dass selbst grössere,
einfache Thiere, wie die Actinien, die Medusen, uns keine deutliche
Spur dieser Zusammensetzung darbieten.
Die Thiere unterscheiden sich aber nicht allein von den Pflanzen
durch das Empfinden und willkührliche Bewegungsvermögen.
Diese Attribute modificiren auch nothwendig die übrigen Eigenschaften,
welche die Thiere mit den Pflanzèn gemein haben. Diess
hat CtrviER in der Einleitung zur vergleichenden Anatomie sehr
schön ausgeführt. Die Gewächse, an den Boden geheftet, absor-
biren unmittelbar durch ihre Wurzeln die ernährenden Theile
der in sie eindringeriden Flüssigkeiten, die Thiere hingegen, diemeist
nicht an ihren Aufenthaltsort gebunden, ihn vielmehr ganz
verändern oder wenigstens als Polypen eines festen Stammes ihie
Beute ergreifen, mussten den ihnen zur Ernährung nöthigen Vorrath
von Säften mit sich fortnehmen können». Die allermeisten
haben eine innere Höhle erhalten, in welche sie die zu-Nahrungsmitteln
bestimmten Stoffe bringen, und in deren Wänden- die einsaugenden
Gefässe bei den höheren Thieren wurzeln, welché nach
einem sehr passenden Ausdruck B oerhave’s währhafte-innere Wurzeln
sind. Cuvier vergl. Anat. T. I . p. 11, Bei einigen Thieren
fehlt der After; bei anderen ist selbst der Darm zweifelhaft. Doch
sollen die Bandwürmer nach Mehlis, gegen die gewöhnliche Annahme,
einen gefässartigen, von der engen Mundöffnung beginnenden,
bald gabelig getheilten Darm haben. Bei den- Echino-
rynchen soll ein bekannter enger,, zweischenkelig gespaltener Canal
der Darm seyn. Eine besondere, zurersten Assimilation bestimmte
Höhle ist noch aus einem andern Grunde nothwendig ï- der Nah-
rungsstoff dèr Thiere muss erst aufgelöst werden. Der Nahrungsstoff
der Pflanze findet sich aufgelöst vor, und besteht theils aus
kohlensäurehaltigem Wasser, theils ans aufgelösten, organischen
Materien des humus. Die Thiere-müssen ihren Nahru-ngsstoff, der
aus schon vorhandenen organischen Verbindungen besteht, vorbereiten,
zerkleinern, auflosen, daher ist die Verdauung eine bloss
den Thieren eigene vorbereitende Assimilation der. Speisen,
Die Saftbewegung der Pflanzen ist viel einfacher als bei den
Thieren, und immer ohne besondere bewegende Organe für die
Verbreitung, ohne Herz. In einigen einfachen Pflanzen giebt es
eine rotatorische Bewegung des Saftes im Innern von Gliedern
:oder in Zellen. Cortj hat diese Bewegung in der Chara entdeckt,
F ontana die beiden T reviranus, Amici, C. H. S chultz, Agardh,
R aspail haben sie in den Charen wieder gesehen; Mkyen hat eine
ähnliche Bewegung in den Zellen der Vallisncria spiraüs und in
den Haaren der Wurzelfasern von Hydrocharis morsus ranae entdeckt.
In den von Saftgefässen durchzogenen höheren Pflanzen
i hat C. H. S chultz eine fortschreitende Bewegung des Saftes entdeckt.
lieber den Kreislauf des Saftes im Schöllkraut. Berlin 1822.
IC. H. Schultz, die Natur der lebendigen Pflanzen. Berlin 1823. An-
{nales des sq. nat. T. XXII. p. "75, 79. Nach S chultz ist diese letztere
Bewegung ein vollkommener Kreislauf, in den einen Gefässen
aufsteigend, in den anderen absteigend, in Quergefässen aber com-
municiren beiderlei Ströme der verschiedenen Gefässe. In den
^Feinen Durchschnitten der Blattstiele vieler Pflanzen sieht man
auch deutlich, dass der Saft in verschiedenen Gefässen verschiedene
Richtung hat, und diess habe ich seihst an feinen Durchschnitten
der Blattstiele von Feigenblättern sehr deutlich gesehen.
Ob nicht die Zerschneidung der Gefässe an der Richtung der
Ströme Antheil habe, kann bloss durch Beobachtungen verschiedener
Ströme in unverletzten Blättern ausgemittelt werden. In
klen Blättern des Chelidonium, die mit dem lebenden Stamme
fnoch verbunden waren, habe ich selbst allerdings entgegengesetzte
Ströme gesehen. Der Umstand, dass nach D utrochet’s
Beobachtungen in einem aufrecht stehenden dünnen Glascylinder
mit Wasser, durch ungleiche Erwärmung, an verschiedener Seite,
isich eine aufsteigende und absteigende rotatorische Bewegung ein-
jktellt,kann ohnehin nicht die Saftbewegung in denPflanzen erklären.
Es scheint daher, dass Anziehung und Abstossung von Seite der Blät-
'ter und Wurzeln -auf eine noch ungekannte Art die Saftbewe-
rgung in den Pflanzen vermitteln. Dass aber das Licht die Säfte
'anzieht, ist wohl gewiss,- da es offenbar das Wachsen der ganzen
Pflanzen bestimmt. Bei den Thieren sind dagegen die Triebfedern
des Kreislaufes weniger äussere Einflüsse, sondern die Zusammenziehung
eines Centralorganes, des Herzens. Diess aber
wird belebt von dem durch den Einfluss der atmosphärischen
Luft beim Athmen veränderten Blute. Ob vollkommene Circula-
tion ein absolutes Prädicat der Thiere ist, ist noch unklar; wir
kennen wenigstens in vielen einfachen Thieren bis jetzt weder
Herz noch Gefässe.
, Das in dem Pflanzen am meisten verbreitete Gewebe, das
^Zellgewebe, welches zugleich zur Fortleitung der Säfte dient, unterscheidet
sich wesentlich vom Zellgewebe der Thiere, es hat
geschlossene Zellen, die sich mit geraden Wänden begrenzen.
[Die Höhlungen des interstitialen Zellgewebes der Thiere liegen
^dagegen unter einander zusammen. Doch war es fehlerhaft den
.•Thieren das Zellgewebe mit geschlossenen Zellen ganz abzuspre-
fchen, solches pflanzenartige Zellgewebe kömmt in mehreren Thei-
len vor, dahin gehört das Fettzellgewebe, welches bei den Wiederkäuern
selbst polyedrisch ist, ferner das Zellgewebe des Glaskörpers
und der chorda dorsalis der Embryonen und Knorpelfische.