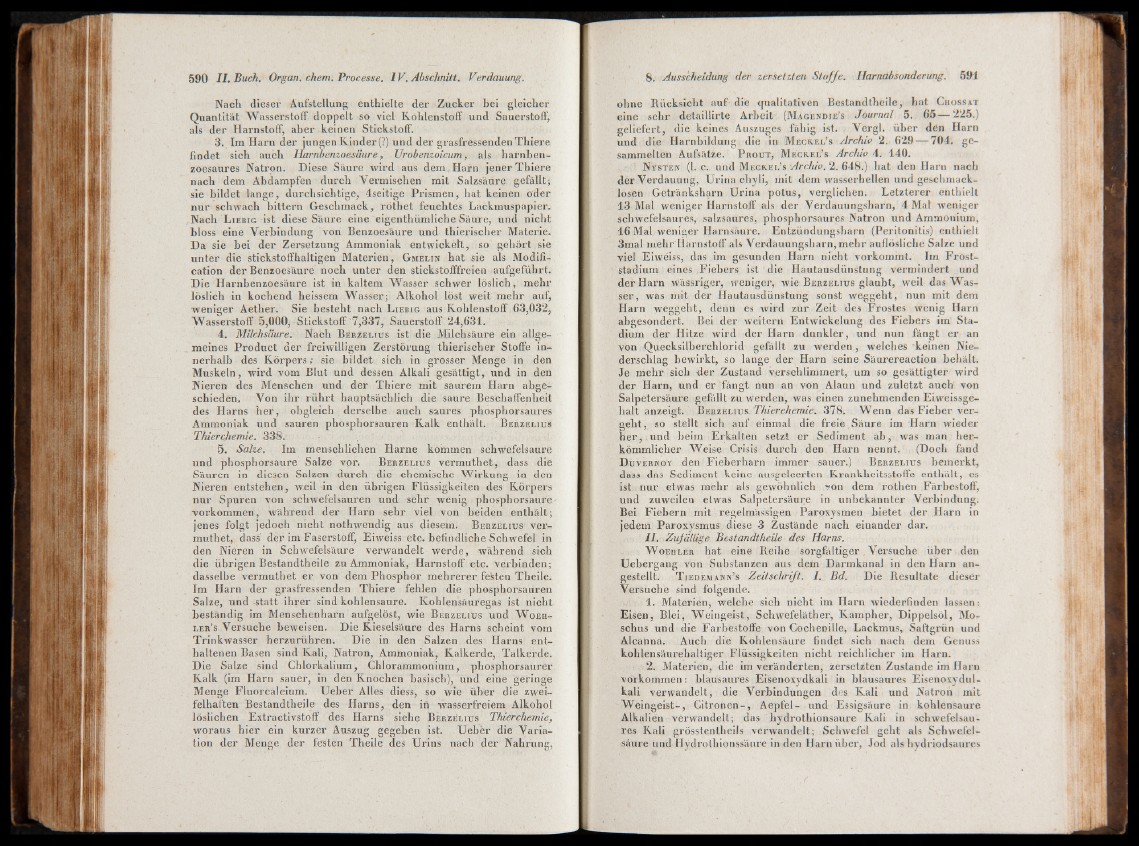
Nach dieser Aufstellung enthielte der Zucker bei gleicher
Quantität Wasserstoff doppelt so viel Kohlenstoff und Sauerstoff,
als der Harnstoff, aber keinen Stickstoff.
3. Im Harn der jungen Kinder (?) und der grasfressenden Thiere
findet sich auch Harnbenzoesäure, Urobenzoicum, als harnbenzoesaures
Natron. Diese Säure wird aus dem, Harn jener Thiere
nach dem Abdampfen durch Vermischen mit Salzsäure gefällt;
sie bildet lange, durchsichtige, dseitige Prismen, hat keinen oder
nur schwach bittern Geschmack, röthet feuchtes Lackmuspapier.
.Nach L iebig ist diese Säure eine eigenthümliehe Säure, und nicht
bloss eine Verbindung von Benzoesäure und thierischer Materie.
Da sie bei der Zersetzung Ammoniak entwickelt, so gehört sie
unter die stickstoffhaltigen Materien, Gmelin hat sie als Modifi-
cation der Benzoesäure noch unter den stickstofffreien aufgeführt.
Die Harnbenzoesäure ist in kaltem Wasser schwer löslich, mehr
löslich in kochend heissem Wasser; Alkohol löst weit mehr auf,
weniger Aether. Sie besteht nach L iebig aus Kohlenstoff 63,032,
Wasserstoff 5,000, Stickstoff'7,337, Sauerstoff 24,631.
4. Milchsäure. Nach Berzelius ist die Milchsäure ein allgemeines
Product der freiwilligen Zerstörung thierischer Stoffe innerhalb
des Körpers; sie bildet sich in grosser Menge in den
Muskeln, wird vom Blut und dessen Alkali gesättigt, und in den
Nieren des Menschen und der Thiere mit saurem Harn abgeschieden,
Von ihr rührt hauptsächlich die saure Beschaffenheit
des Harns hef, obgleich derselbe auch saures phosphorsaures
Ammoniak und sauren phosphorsanren Kalk enthält. Berzelius
Thierchemie. 338.
5. Salze. Im menschlichen Harne kommen schwefelsaure
und phosphorsaure Salze vor. Berzelius vermuthet, dass die
Säuren in diesen Salzen durch die chemische Wirkung in den
Nieren entstehen, weil in den übrigen Flüssigkeiten des Körpers
nur Spuren von schwefelsauren und sehr wenig phosphorsaure
Vorkommen, während der Harn sehr viel von beidenenthält;
jenes folgt jedoch nicht nothwendig aus diesem. Berzelius vermuthet,
dass der im Faserstoff, Eiweiss etc. befindliche Schwefel in
den Nieren in Schwefelsäure verwandelt werde, während sich
die übrigen Bestandtheile zu Ammoniak, Harnstoff etc. verbinden;
dasselbe vermuthet er von dem Phosphor mehrerer festen Theile.
Im Harn der grasfressenden Thiere fehlen die phosphorsauren
Salze, und -statt ihrer sind kohlensaure. Kohlensäuregas ist nicht
beständig im Menschenharn aufgelöst, wie Berzelius und W oeh-
ler’s Versuche beweisen. Die Kieselsäure des Harns scheint vom
Trinkwasser herzurühren. Die in den Salzen des Harns enthaltenen
Basen sind Kali, Natron, Ammoniak, Kalkerde, Talkerde.
Die Salze sind Chlorkalium, Chlorammonium, phosphorsaurer
Kalk (im Harn sauer, in den Knochen basisch), und eine geringe
Menge Fluorcalcium. Ueber Alles diess, so wie über die zweifelhaften
Bestandtheile des Harns, den in wasserfreiem Alkohol
löslichen Extractivstoff des Harns siehe Berzölius Thierchemie,
woraus hier ein kurzer Auszug gegeben ist. Ueber die Variation
der Menge der festen Theile des Urins nach der Nahrung,
ohne Rücksicht auf die qualitativen Bestandtheile, hat Chossat
eine sehr detaillirte Arbeit (Magendie’s Journal 5. 65 — 225.)
geliefert, die keines Auszuges fähig ist. Vergl. über den Harn
und die Harnbildung, die in Meckel’s Archiv 2. 629 — 704. gesammelten
Aufsätze. P rout, Meckel’s Archiv 4. 140.
Nysten (1. c. und Mecrel’s Archiv. 2. 648.) hat den Harn nach
der Verdauung, Urina chyli, mit dem wasserhellen und geschmacklosen
Getränksharn Urina potus, verglichen. Letzterer enthielt
13 Mal weniger Harnstoff als der Verdauungsharn, 4 Mal weniger
schwefelsaures, salzsaures, phosphorsaures Natron und Ammonium,
16 Mal weniger Harnsäure. Entzündungsharn (Peritonitis) enthielt
3mal mehr Harnstoff als Verdäuungsliarn, mehr auflösliche Salze und
viel Eiwéiss, das im gesunden Harn nicht vorkommt. Im Froststadium
eines .Fiebers ist die Hautausdünstung vermindert und
der Harn wässriger, weniger, wie Berzelius glaubt, weil das Wasser,
was mit der Hautausdünstung sonst weggeht, nun mit dem
Harn weggeht, denn es wird zur Zeit des Frostes wenig Harn
abgesondert. Bei der weitern Entwickelung des Fiebers im Stadium
der Hitze wird der Harn dunkler, und nun fängt er an
von Quecksilberchlorid gefällt zu werden, welches keinen Niederschlag
bewirkt, so lange der Harn seine Säurereaction behält.
Je mehr sich der Zustand verschlimmert, um so gesättigter wird
der Harn, und er fängt nun an von Alaun und zuletzt auch von
Salpetersäure, gefällt zu werden, was einen zunehmenden Eiweissgehalt
anzeigt. Berzelius- Thitrehemie. 378. Wenn das Fieber vergeht,
so stellt sich auf 'einmal die freie . Säure im Harn wieder
her, und beiin Erkalten setzt er Sediment ab, was man herkömmlicher
Weise Crisis durch den Harn nennt. (Doch fand
D uvernoy den Fieberharn immer sauer.) Berzelius bemerkt,
dass das Sediment keine ausgeleerten Krankheitsstoffe enthält, es
ist nur etwas mehr als gewöhnlich von dem rothen Färbestoff,
und zuweilen etwas Salpetersäure in unbekannter Verbindung.
Bei Fiebern mit regelmässigen Paroxysmen bietet der Harn in
jedem Paroxysmus diese 3 Zustände nach einander dar.
II. Zujällige Bestandtheile des Harns.
W oehler hat eine Reihe sorgfältiger , Versuche über den
Üebergang von Substanzen aus dem Darmkanal in den Harn angestellt.
T iedemann’s Zeitschrift. I. Bd. Die Resultate dieser
Versuche sind folgende.
1. Materien, welche sich nicht im Harn wiederfinden lassen:
Eisen, Blei, Weingeist, Schwefeläther, Kampher, Dippelsöl, Moschus
und die Farbestoffe von Cochenille, Lackmus, Saftgrün und
Alcaimä. Auch die Kohlensäure findet sich nach dem Genuss
kohlensäurehaltiger Flüssigkeiten nicht reichlicher im Harn.
2. Materien, die im veränderten, zersetzten Zustande im Harn
Vorkommen: blausaures Eisenoxydkali in blausaures Eisenoxydulkali
verwandelt, die Verbindungen des Kali und Natron mit.
Weingeist-, Citronen-, Aepfel- und Essigsäure in kohlensaure
Alkalien verwandelt; das hydrothionsaure Kali in schwefelsaures
Kali grösstentheils verwandelt; Schwefel geht als Schwefelsäure
und Hydrotbionssäure in den Harn über, Jod als hydriodsaures