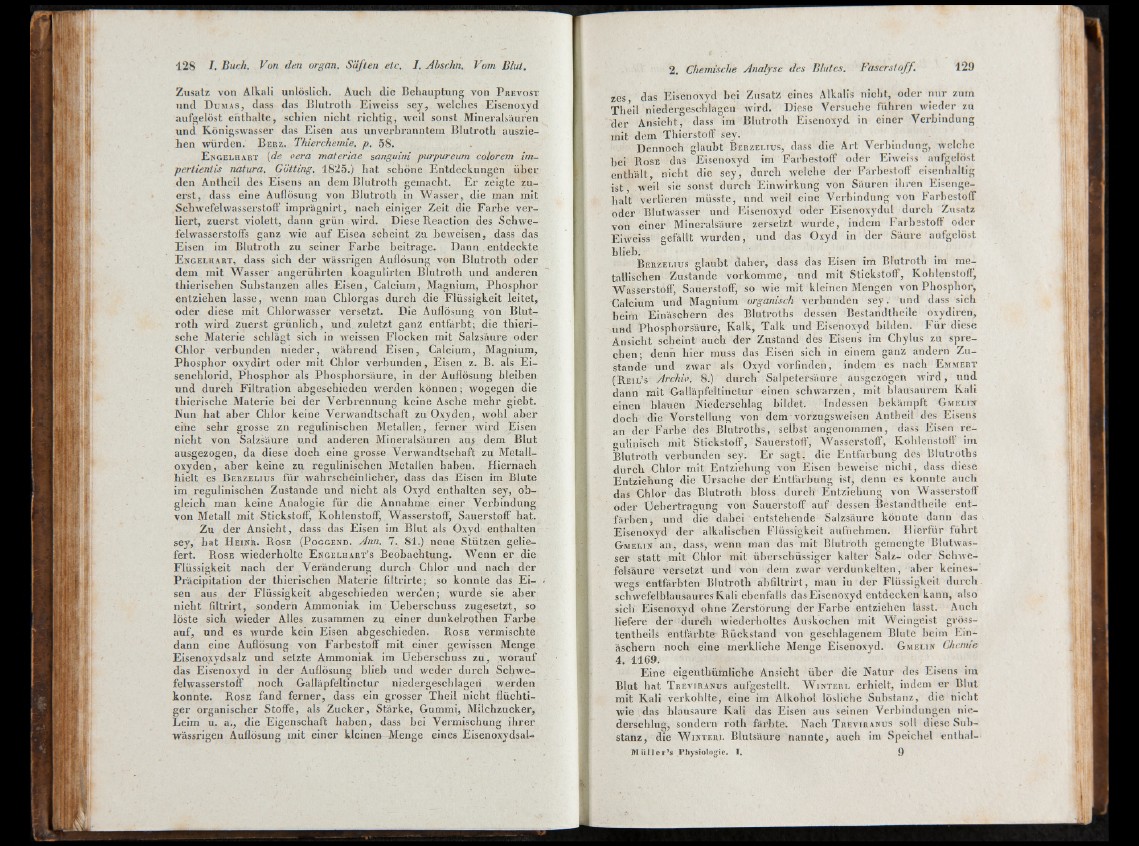
Zusatz von Alkali unlöslich. Auch die Behauptung von P revost
und D umas, dass das Blutroth Eiweiss sey, welches Eisenoxyd
aufgelöst enthalte, schien nicht richtig, weil sonst Mineralsäuren
und Königswasser das Eisen aus unverbranntern Blutroth auszie-
hen würden. B erz, Thierchemie, p . 58.
E ngelhart {de vera materiae sanguini purpureum colorem im-
pertientis natura. Gotting. 1825.) hat schöne Entdeckungen über
den Antheil des Eisens an dem Blutroth gemacht. Er zeigte zuerst,
dass eine Auflösung von Blutroth in Wasser, die man mit
Schwefelwasserstoff imprägnirt, nach einiger Zeit die Farbe verliert,
zuerst violett, dann grün wird. Diese Reaction des Schwefelwasserstoffs
ganz wie auf Eisen scheint zu beweisen, dass das
Eisen im Blutroth zu seiner Farbe beitrage. Dann . entdeckte
E ngelhart, dass sich der wässrigen Auflösung von Blutroth oder
dem mit Wasser' angerührten koagulirten Blutroth und anderen
thierischen Substanzen alles Eisen, Calcium, Magnium, Phosphor
entziehen lasse, wenn man Chlorgas durch die Flüssigkeit leitet,
oder diese mit Chlorwasser versetzt. Die Auflösung von Blutroth
wird zuerst grünlich, und zuletzt ganz entfärbt; die thieri-
sche Materie schlägt sich in weissen Flocken mit Salzsäure oder
Chlor verbunden nieder, während Eisen, Calcium, Magnium,
Phosphor oxydirt oder mit Chlor verbunden, Eisen z. B. als Eisenchlorid,
Phosphor als Phosphorsäure, in der Auflösung bleiben
und durch Filtration abgeschieden werden können; wogegen die
tbierische Materie bei der Verbrennung keine Asche mehr giebt.
Nun hat aber Chlor keine Verwandtschaft zu'Oxyden, wohl aber
eine sehr grosse zn regulinischen Metallen, ferner wird Eisen
nicht von Salzsäure und anderen Mineralsäuren aus dem Blut
ausgezogen, da diese doch eine grosse Verwandtschaft zu Metalloxyden,
aber keine zu regulinischen Metallen haben. Hiernach
hielt es B erzelius für wahrscheinlicher, dass das Eisen im Blute
im regulinischen Zustande und nicht als Oxyd enthalten sey, obgleich
man keine Analogie für die Annahme einer Verbindung
von Metall mit Stickstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff hat.
Zu der Ansicht, dass das Eisen im Blut als Oxyd enthalten
sey, hat H einr. R ose (P oggend. Ann. 7, 81.) neue Stützen geliefert.
R ose wiederholte E ngelhart’s Beobachtung. Wenn er die
Flüssigkeit nach der Veränderung durch Chlor und nach der
Präcipitation der thierischen Materie filtrirte; ' so konnte das Eisen
aus der Flüssigkeit abgeschieden werden; wurde sie aber
nicht filtrirt, sondern Ammoniak im Ueberschuss zugesetzt, so
löste sich wieder Alles zusammen zu einer dunkelrothen Farbe
auf, und es wurde kein Eisen abgeschieden. R ose vermischte
dann eine Auflösung von Färbestoff mit einer gewissen Menge
Eisenoxydsalz und setzte Ammoniak im Ueberschuss zu, worauf
das Eisenoxyd in der Auflösung blieb und weder durch Schwefelwasserstoff
noch Galläpfeltinctur niedergeschlagen werden
konnte. R ose fand ferner, dass ein grosser Theil nicht flüchtiger
organischer Stoffe, als Zucker, Stärke, Gummi, Milchzucker,
Leim u. a., die Eigenschaft haben, dass bei Vermischung ihrer
wässrigen Auflösung mit einer kleinen Menge eines Eisenoxydsalzes
das Eisenoxyd bei Zusatz eines Alkalis nicht, oder nur zum
Theil niedergeschlagen wird. Diese Versuche führen wieder zu
der Ansicht, dass im Blutroth Eisenoxyd in einer Verbindung
mit dem Thierstoff sey.
Dennoch glaubt B erzelius, dass die Art Verbindung, welche
bei R ose das Eisenoxyd im Farbestoff oder Eiweiss aufgelöst
enthält, nicht die sey, durch welche der Farbestoff eisenhaltig
ist weil sie sonst durch Einwirkung von Säuren ihren Eisengehalt
verlieren müsste, und weil eine Verbindung von Farbestoff
oder Blutwasser und Eisenoxyd oder Eisenoxydul durch Zusatz
von einer Mineralsäure zersetzt wurde, indem Faibestoff oder
Eiweiss gefällt wurden, und das Oxyd in der Säure aufgelöst
Mieb.B
erzelius glaubt daher, dass das Eisen im Blutroth im metallischen
Zustande vorkomme, und mit Stickstoff, Kohlenstoff,
Wasserstoff, Sauerstoff, so wie mit kleinen Mengen von Phosphor,
Calcium und Magnium organisch verbunden sey. und dass sich
beim Einäschern des Blutroths dessen Bestandtheile oxydiren,
Tind Phosphorsäure, Ealk, Talk und Eisenoxyd bilden. Für diese
Ansicht scheint auch der Zustand des Eisens im Chylus zu sprechen;
denn hier muss das Eisert sich in einem ganz andern Zustande
und zwar als Oxyd vorfinden, indem es nach E mmert
(R eil’s Archiv. 8.) durch Salpetersäure_ ausgezogen wird, und
dann mit Galläpfeltinctur einen schwarzen, mit blausaurem Kali
einen blauen Niederschlag bildet. Indessen bekämpft G melin
doch die Vorstellung von dem vorzugsweisen Antheil des Eisens
an der Farbe des Blutroths, selbst angenommen, dass Eisen re-
gülinisch mit Stickstoff, ; Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff im
Blutroth verbunden sey. Er sagt, die Entfärbung des Blutroths
durch Chlor mit Entziehung von Eisen beweise nicht, dass diese
Entziehung die Ursache der Entfärbung ist, denn es könnte auch
das Chlor das Blutroth bloss, durch Entziehung von Wasserstoff
oder Uebertragung von Sauerstoff auf dessen Bestandtheile entfärben,
und die dabei entstehende Salzsäure könnte dann das
Eisenoxyd der alkalischen Flüssigkeit aufnehmen. Hierfür führt
G melin an., dass, wenn man das mit Blutroth gemengte Blutwasser
statt .mit Chlor mit überschüssiger kalter Salz- oder Schwefelsäure
versetzt und von dem zwar verdunkelten, aber keineswegs
entfärbten Blutroth abfiltrirt, man in der Flüssigkeit durch,
schwefelblausaures Kali ebenfalls das Eisenoxyd entdecken kann, also
sich' Eisenoxyd ohne Zerstörung der Farbe entziehen lässt. Auch
liefere der durch wiederholtes Auskochen mit Weingeist gröss-
tentheils entfärbte- Rückstand von geschlagenem Blute beim Einäschern
noch eine merkliche Menge Eisenoxyd. G melin Chemie
4. 1169.
Eine eigentümliche Ansicht über die Natur des Eisens im
Blut hat T reviranus aufgestellt. W interl erhielt, indem er Blut
mit Kali verkohlte, eine im Alkohol lösliche Substanz, die nicht
wie ^das blausaure Kali das Eisen aus seinen Verbindungen niederschlug,
sondern roth färbte, Nach T reviranus soll diese Substanz,
die W interl Blutsäure nannte, auch im Speichel enthal-
M iiflc r’s Physiologie. I, 9