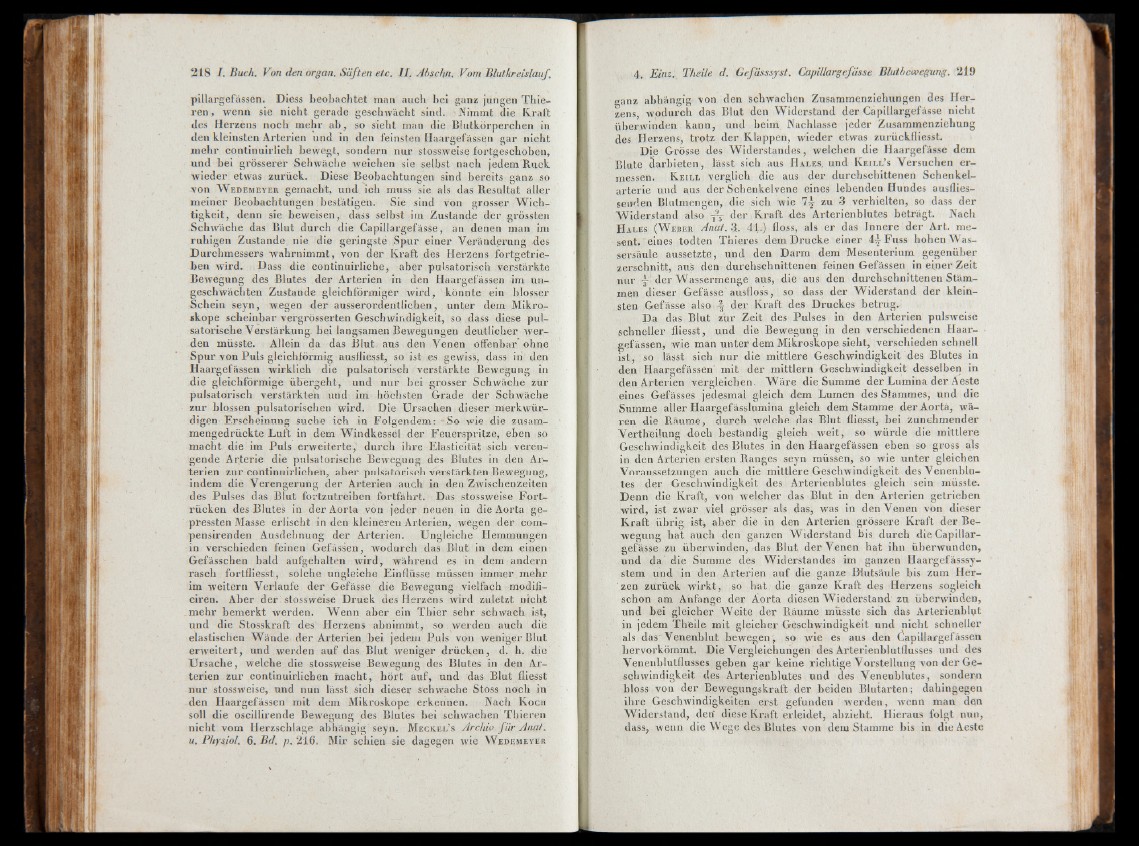
pillargefässen. Diess beobachtet man auch bei ganz jungen Thie-
ren, wenn sie nicht gerade geschwächt sind. 'Nimmt die Kraft
des Herzens noch mehr ab, so sieht man die Blutkörperchen in
den kleinsten Arterien und in den feinsten Haargefässen gar nicht
mehr continuirlich bewegt, sondern nur stossweise fortgeschobeu,
und bei grösserer Schwäche weichen sie selbst nach jedem Ruck
wieder etwas zurück. Diese Beobachtungen sind bereits ganz so
von W edemeyer gemacht, und ich muss sie als das Resultat aller
meiner Beobachtungen bestätigen. Sie sind von grosser Wichtigkeit,
denn sie beweisen, dass selbst im Zustande der grössten
Schwäche das Blut durch die Capillargefässe, an denen man im
ruhigen Zustande nie die geringste Spur einer Veränderung des
Durchmessers wahrnimmt, von der Kraft des Herzens fortgetrieben
wird. Dass die continuirliehe, aber pulsatorisch verstärkte
Bewegung des Blutes der Arterien in den Haargefässen im un-
geschwächten Zustande gleichförmiger wird, könnte ein blosser
Schein seyn, wegen der ausserordentlichen, unter dem Mikroskope
scheinbar vergrösserten Geschwindigkeit, so dass diese pul-
satorische Verstärkung, bei langsamen Bewegungen deutlicher werden
müsste. Allein da das Blut aus den Venen offenbar ohne
Spur von Puls gleichförmig ausfliesst, so ist es gewiss, dass in den
Haargefässen wirklich die pulsatorisch verstärkte Bewegung in
die gleichförmige übergeht, und nur bei grosser Schwäche zur
pulsatorisch verstärkten und im höchsten Grade der Schwäche
zur blossen pulsatorischen wird. Die Ursachen dieser merkwürdigen
Erscheinung suche ich in Folgendem: *So wie die zusammengedrückte
Luft in dem Windkessel der Feuerspritze^ eben so
macht die im Puls erweiterte,' durch ihre Elasticität sich verengende
Arterie die pulsatorische Bewegung des Blutes in den Arterien
zur continuirlichen, aber pulsatorisch verstärkten Bewegung,
indem die Verengerung der Arterien auch in den Zwischenzeiten
des Pulses das Blut fortzutreiben fortfährt. Das stossweise Fortrücken
des Blutes in der Aorta von jeder neuen in die Aorta gepressten
Masse erlischt in den kleineren Arterien, wegen der com-
pensirenden Ausdehnung der Arterien. Ungleiche Hemmungen
in verschieden feinen Gefässen, wodurch das Blut in dem einen
Gefässchen bald aufgehalten wird, während es in dem andern
rasch fortfliesst, solche ungleiche Einflüsse müssen immer mehr
im weitern Verlaufe der Gefässe die Bewegung vielfach modifi-
ciren. Aber der stossweise Druck des Herzens wird zuletzt nicht
mehr bemerkt werden. Wenn aber ein Thier sehr schwach ist,
und die Stosskraft des Herzens abnimmt, so, werden auch di'e
elastischen Wände der Arterien bei jedem Puls von weniger Blut
erweitert, und werden auf das Blut weniger drücken, d. h. die
Ursache, welche die stossweise Bewegung des Blutes in den Arterien
zur continuirlichen macht, hört auf, und das Blut fliesst
nur stossweise, und nun lässt sich dieser schwache Stoss noch in
den Haargefässen mit dem Mikroskope erkennen. Nach Koch
soll die oscillirende Bewegung des Blutes bei schwachen Thieren
nicht vom Herzschlage abhängig seyn. Meckel’s Archiv für Anat.
u. Physiol. 6 . Bd. p. 216. Mir schien sie dagegen wie W edemeyer
ganz abhängig von den schwachen Zusammenziehnngen des Herzens
wodurch das Blut den Widerstand der Capillargefässe nicht
überwinden kann, und beim Nachlasse jeder Zusammenziehung
des Herzens, trotz der Klappen, wieder etwas zurückfliesst.
Die Grösse des Widerstandes, welchen die Haargefässe dem
Blute äarbieten, lässt sich aus H ales. und Keill’s Versuchen ermessen.
K eile verglich die aus der durchschittenen Schenkelarterie
und aus der Schenkelvene eines lebenden Hundes ausflies-
senden Blutmengen, die sich wie 7X zu 3 verhielten, so dass der
Widerstand also xx der Kraft des Arterienblutes beträgt. Nach
H ales (W eber Anat. 3. 41.) floss, als er das Innere der Art. me-
sent. eines todten Thieres dem Drucke einer 4x Fuss hohen Wassersäule
aussetzte, und den Darm dem Mesenterium gegenüber
zerschnitt, aus den durchschnittenen feinen Gefässen in einer Zeit
nur x der Wassermenge aus, die aus den durchschnittenen Stämmen
dieser Gefässe'ausfloss, so dass der Widerstand der kleinsten
Gefässe also y der Kraft des Druckes betrug.
Da das Blut zur Zeit des Pulses in den Arterien pulsweise
schneller fliesst, und die Bewegung in den verschiedenen Haargefässen,
wie man unter dem Mikroskope sieht, verschieden schnell
ist, so lässt sich nur die mittlere Geschwindigkeit des Blutes in
den Haargefässen' mit der mittlern Geschwindigkeit desselben in
den Arterien vergleichen. Wäre die Summe der Lumina der Aeste
eines Gefässes jedesmal gleich dem Lumen des Stammes, und die
Summe aller Haargef ässltimina gleich dem Stamme der Aorta, wären
die Räume, durch welche das Blut fliesst, bei zunehmender
Verth'eilung doch beständig gleich weit, so würde die mittlere
Geschwindigkeit des Blutes in den Haargefässen eben so gross als
in den Arterien ersten Ranges seyn müssen, so wie unter gleichen
Voraussetzungen auch die mittlere Geschwindigkeit des Venenblutes
der Geschwindigkeit des Arterienblutes gleich sein müsste.
Denn die Kraft, von welcher das Blut in den Arterien getrieben
wird, ist zwar viel grösser als das, was in den Venen von dieser
Kraft übrig ist, aber die in den Arterien grössere Kraft der Bewegung
hat auch den ganzen Widerstand bis durch die Capillargefässe
zu überwinden, das Blut, der Venen hat ihn überwunden,
und da' die Summe des Widerstandes im ganzen Haargef ässsy-
stem und in den Arterien auf die ganze ßiutsäule bis zum Herzen
zurück wirkt, so hat, die ganze Kraft des Herzens sogleich
schon am Anfänge der Aorta diesen Wiederstand zu überwinden,
und bei gleicher Weite der Räume müsste sich das Arterienblut
in jedem Theile mit gleicher Geschwindigkeit und nicht schneller
als das Venenblut bewegen", so wie es aus den Capillargefässen
hervorkömmt. Die Vergleichungen des Arterienblutflusses und des
Venenblutflusses geben gar keine richtige Vorstellung von der Geschwindigkeit
des Arterienblutes und des Venenblutes, sondern
bloss von der Bewegungskraft der beiden Blutarten; dahingegen
ihre Geschwindigkeiten erst gefunden werden, wenn man den
Widerstand, den' diese Kraft erleidet, abzieht. Hieraus folgt nun,
dass, wenn die Wege des Blutes, von dem Stamme bis in die Aeste