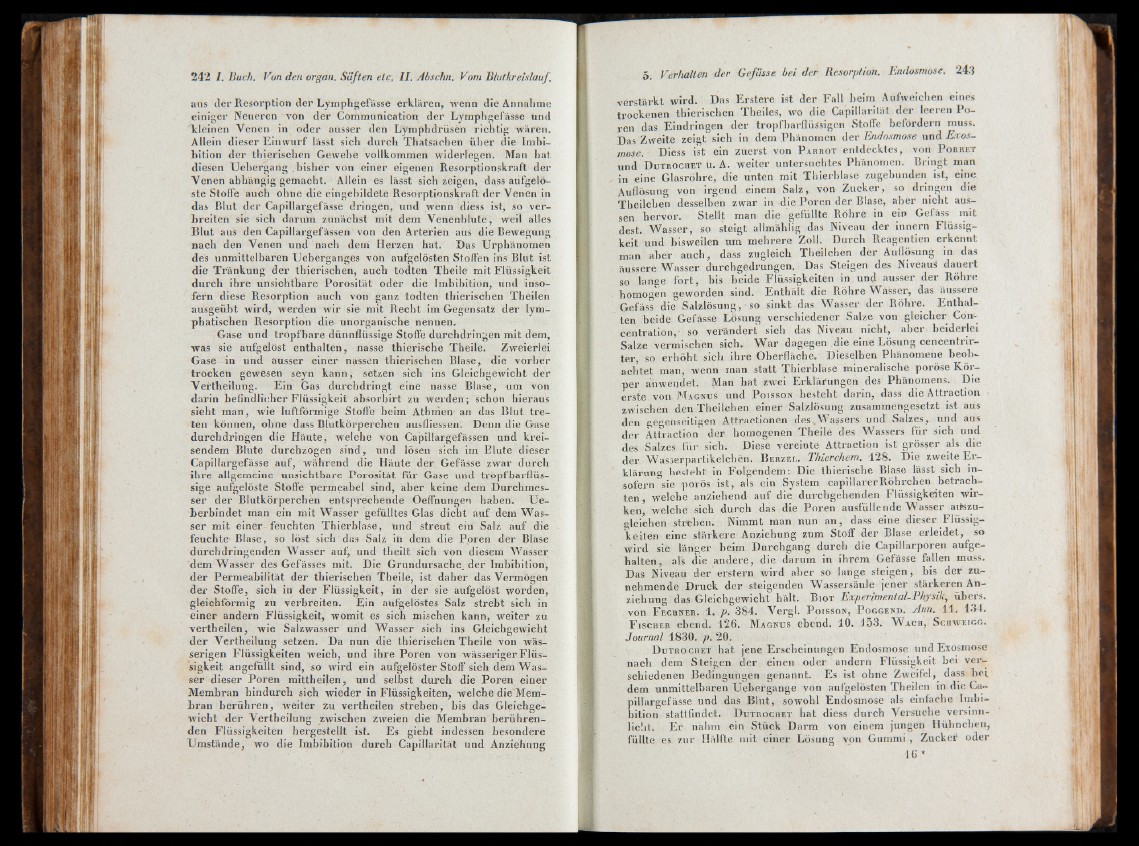
aus der Resorption der Lymphgefässe erklären, wenn die Annahme
einiger Neueren von der Communication der Lymphgefässe und
kleinen Venen in oder ausser den Lymphdrüsen richtig wären.
Allein dieser Einwurf lässt sich durch Thatsachen über die Imbibition
der thierischen Gewebe vollkommen widerlegen. Man hat
diesen Uebergang .bisher von einer eigenen Resorptionskraft der
Venen abhängig gemacht. Allein es lässt sich zeigen, dass aufgelöste
Stoffe auch ohne die eingebildete Resorptionskraft der Venen in
das Elut der Capillargefässe dringen, und wenn diess ist, So verbreiten
sie sich darum zunächst mit dem Venenhlute, weil alles
Blut aus den Capillargefässen von den Arterien aus die Bewegung
nach den Venen und nach derii Herzen hat. Das XJrpbänomen
des unmittelbaren Ueberganges von aufgelösten Stoffen ins Blut ist
die Tränkung der thierischen, auch todten Theile mit Flüssigkeit
durch ihre unsichtbare Porosität oder die Imbibition, und insofern
diese Resorption auch von ganz todten thierischen Theilen
ausgeübt wird, werden wir sie mit Recht im Gegensatz der lymphatischen
Resorption die- unorganische nennen.
Gase und tropfbare dünnflüssige Stoffe durchdrin'gen mit dem,
was sie aufgelöst enthalten, nasse thierische Theile. Zweierlei
Gase in und ausser einer nassen thierischen Blase, die vorher
trocken gewesen seyn kann, setzen sich ins Gleichgewicht der
Vertheilung. Ein' Gas durchdringt eine nasse Blase, um von
darin befindlicher Flüssigkeit absorbirt zu werden; schon hieraus
sieht man, wie luftförmige Stoffe beim Athnien an das Blut treten
können, ohne dass Blutkörperchen ausfliessen. Denn die Gase
durchdringen die Häute, welche von Capillargefässen und kreisendem
Blute durchzogen sind, und lösen sich im Elute dieser
Capillargefässe auf, während die Häute der. Gefässe zwar durch
ihre allgemeine unsichtbare Porosität für Gase und tropfbarflüssige
aufgelöste Stoffe permeabel sind, aber keine dem Durchmesser
der Blutkörperchen entsprechende Oeffnungen haben. TJe-
berbindet man ein mit Wasser gefülltes Glas dicht auf dem Wasser
mit einer feuchten Thierblase, und streut ein Salz auf die
feuchte' Blase, so löst sich das Salz in dem die Poren der Blase
durchdringenden Wasser auf, und fllrei.lt sich von diesem Wasser
dem Wasser des Gefässes mit. Die Grundursache, der Imbibition,
der Permeabilität der thierischen Theile, ist daher das Vermögen
der Stoffe, sich in der Flüssigkeit, in der sie aufgelöst worden,
gleichförmig zu verbreiten. Ein aufgelöstes Salz strebt sich in
einer andern Flüssigkeit, womit es sich mischen kann, weiter zu
vertheilen, wie Salzwasser und Wasser sich ins Gleichgewicht
der Vertheilung setzen. Da nun die thierischen Theile von wässerigen
Flüssigkeiten weich, und ihre Poren von wässeriger Flüssigkeit
angefüllt sind, so wird ein aufgelöster Stoff sich dem Wasser
dieser Poren mittheilen, und selbst durch die Poren, einer
Membran hindurch sich wieder in Flüssigkeiten, welche die'Mem-
bran berühren, weiter zu vertheilen streben, bis das Gleichgewicht
der Vertheilung zwischen zweien die Membran berührenden
Flüssigkeiten hergestellt ist. Es giebt indessen besondere
Umstände, wo die Imbibition durch Capillarität und Anziehung
verstärkt wird. Das Erstere ist der Fall beim Aufweichen eines
trockenen thierischen Theiles, wo die Capillarität der leeren Poren
das Eindringen der tropfbarflüssigen Stoffe befördern muss.
Das Zweite zeigt sich in dem Phänomen der Endosmose und Exosmose.
Diess ist ein zuerst von P arrot entdecktes, von P orret
und D utrochet ü. A. weiter untersuchtes Phänomen. Bringt man
in eine Glasröhre, die unten mit Thierblase zugebunden ist, eine
Auflösung von irgend einem Salz, von Zucker, so dringen die
Theilchen desselben zwar in die Poren der Blase, aber nicht aussen
hervor. Stellt man die gefüllte Röhre in ein Gefäss mit
dest. Wasser, so steigt allmähfig das Niveau der innern Flüssigkeit
und bisweilen um mehrere Zoll. Durch Reagentien erkennt
man aber auch, dass zugleich Theilchen der Auflösung in das
äussere Wasser dürchgedrungen. Das Steigen des Niveaus dauert
so lange fort, bis beide Flüssigkeiten in und ausser der Rohre
homogen geworden sind. Enthält die Röhre Wüsser, das äussere
Gefäss die Salzlösung, so sinkt das Wasser der Röhre. Enthalten
beide Gefässe Lösung verschiedener Salze von gleicher Con-
centration,- so verändert sich das Niveau nicht, aber beiderlei
Salze vermischen sich. War dagegen die eine Lösung cencentrir-
ter, so erhöht sich ihre Oberfläche. Dieselben Phänomene beobachtet
man, wenn man, statt Thierblase mineralische poröse Körper
anweqdet. Man hat zwei Erklärungen des Phänomens. Die
erste von M agnus und P oisson besteht darin, dass die Attraction >
zwischen den Theilchen einer Salzlösung zusammengesetzt ist aus
den gegenseitigen Attractionen des,,Wassers und Salzes, und aus
der Attraction der homogenen Theile des Wassers für sich und
des Salzes für sich. Diese vereinte Attraction ist grösser als die
der Wasserpartikelchen. B erzel. Thierchem. 128. Die zweite Erklärung
besteht in Folgendem: Die thierische Blase lässt sich insofern
sie porös ist, als ein System capillarerRöhrchen betrachten
, welche anziehend auf die durchgehenden Flüssigkeiten wirken,
welche sich durch das die Poren ausfüllende Wasser artszu-
«leichen streben. Nimmt man nun an, dass eine dieser Flüssigkeiten
eine stärkere Anziehung zum Stoff der Blase erleidet, so
wird sie länger beim Durchgang durch die Capillarporen aufgehalten,
als die andere, die darum in ihrem Gefässe fallen muss.
Das Niveau der erstem wird aber so lange steigen, bis der zunehmende
Druck der steigenden Wassersäule jener stärkeren Anziehung
das Gleichgewicht hält. Biot Experimental-Physik, übers,
von F echner. 1. p. 384. Vergl. P oisson, P oggend. Anti. 11. 134.
F ischer ebend. 126. Magnus ebend. 10. 153. W ach, S chweigg.
Journal 1830. p. 20.
D utrochet hat jene Erscheinungen Endosmose und Exosmose
nach dem Steigen der einen oder andern Flüssigkeit bei verschiedenen
Bedingungen genannt. Es ist ohne Zweifel, dass bei
dem unmittelbaren Debergange von aufgelösten Theilen in die Capillargefässe
und das Blut, sowohl Endosmose als einfache Imbibition
stattfindet. D utrochet hat diess durch Versuche versinnlicht.
Er nahm ein Stück Darm von einem jungen Hühnchen,
füllte es zur Hälfte mit einer Lösung von Gummi , Zucker oder