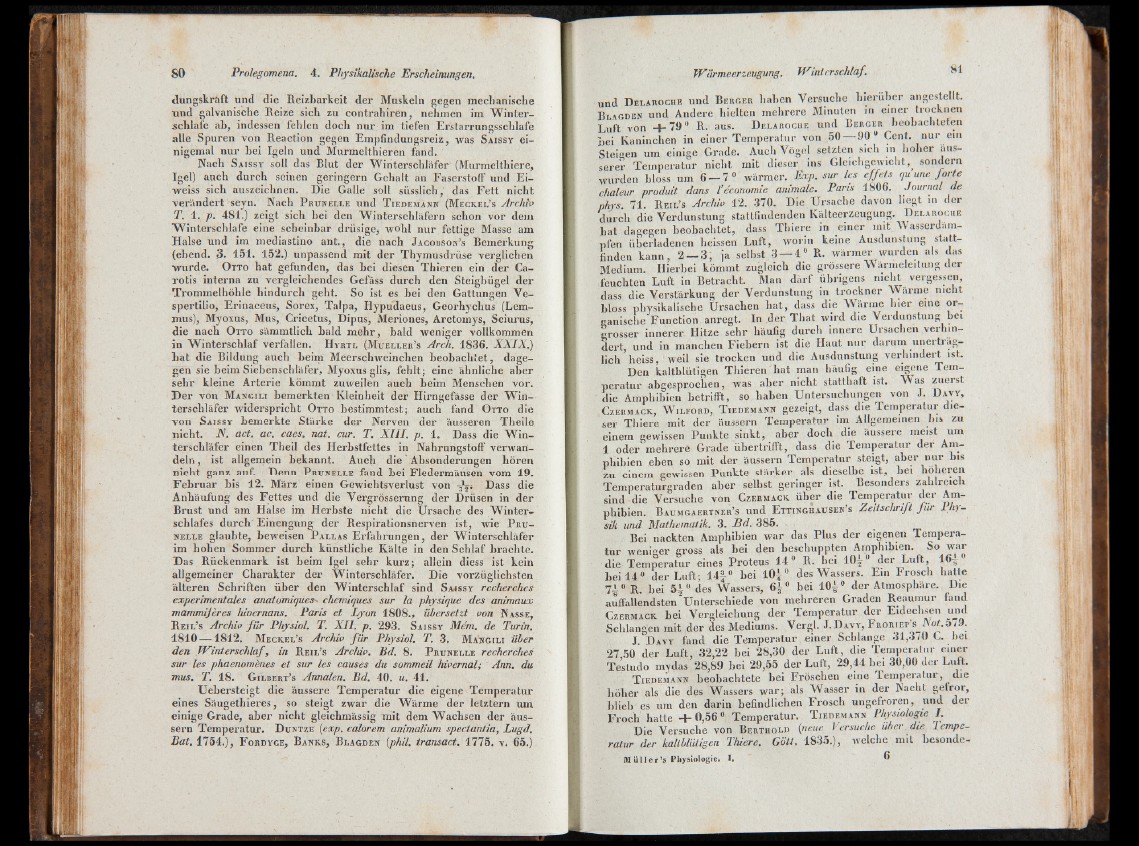
dungskräft and die Reizbarkeit der Mnskeln gegen mechanische
und galvanische Reize sich zu contrahiren, nehmen im Winterschlaf
ab, indessen fehlen doch nur im tiefen Erstarrungsschlafe
alle Spuren von Reaction gegen Empfindungsreiz, was Saissy einigemal
nur hei Igeln upd Murmelthieren fand.
Nach Saissy soll das Blut der Winterschläfer (Murmelthiere,
Igel) auch durch seinen geringem Gehalt an Faserstoff' und Ei-
weiss sich auszeichnen. Die Galle soll süsslieh,' das Fett nicht
verändert seyn. Nach P runelle und T iedemann (Meckel’s Archiv
T. 1. p. 481.) zeigt sich, bei den Winterschläfern schon vor dein
Winterschlafe eine scheinbar drüsige, wohl nur fettige Masse am
Halse und im mediastino ant., die nach J acobson’s Bemerkung
(ehend. 3- 151. 152.) unpassend mit der Thymusdrüse verglichen
wurde. O tto hat gefunden, das bei diesen Thieren ein der Carotis
interna zu vergleichendes Gefäss durch den Steigbügel der
Trommelhöhle hindurch geht. So ist es bei den Gattungen Ve-
spertilio, Erinaceus, Sorex, Talpa, Hypüdaeus, Georhychus (Lem-
mus), Myoxus, Mus, Cricetus, Dipus, Meriones, Arctomys, Sciurus,
die nach O tto sämmtlich bald mehr, bald weniger vollkommen
in Winterschlaf verfallen. H yktl (Mueller’s Arch. 1836. XXIX.)
hat die Bildung auch beim Meerschweinchen beobachtet, dagegen
sie beim Siebenschläfer, Myoxus glis, fehlt; eine ähnliche aber
sehr kleine Arterie kömmt zuweilen auch beim Menschen vor.
Der von Mangili bemerkten Kleinheit der Hirngefässe der Win-
terschläfer widerspricht O tto bestimmtest; auch fand O tto die
von Saissy bemerkte Stärke der Nerven der äusseren Theile,
nicht. IV. act. ac. caes. nat. cur. T. X III. p. 1. Dass die Winterschläfer
einen Theil des Herbstfettes in Nahrungstoff1 verwandeln
, ist allgemein bekannt. Auch die' Absonderungen hören
nicht ganz auf. Denn P runelle fand bei Fledermäusen vom 19.
Februar bis 12. März einen Gewichtsverlust von Dass die
Anhäufung des Fettes und die Yergrösserung der Drüsen in der
Brust und mn Halse im Herbste nicht die Ursache des Winter,,
schlafes durch Einengung der Respirationsnerven ist, wie P runelle
glaubte, beweisen P allas Erfahrungen, der Winterschläfer
im hohen Sommer durch künstliche Kälte in den Schlaf brachte.
Das Rückenmark ist beim Igel sehr kurz; allein diess ist kein
allgemeiner Charakter der Winterschläfer. Die vorzüglichsten
älteren Schriften über den Winterschlaf sind Saissy recherches
experimentales anatomiques^ chemiques sur la physique des animaux
mammifères hioernans. Paris et Lyon 1808., übersetzt . von Nasse,
R eil’s Archiv fü r Physiol. T. XII. p. 293. Saissy Mém. de Turin.
1810 —1812. M eckel’s Archiv fü r Physiol. T. 3. Mangili über
den Winterschlaf, in R eil’s Archiv. Bd. 8. P runelle recherches
sur les phaenomènes et sur les causes du sommeil hivernal; Ann. du
mus. T. 18. G ilbert’s Annalen. Bd. 40. u. 41.
Uebersteigt die äussere Temperatur die eigene Temperatur
eines Säugethieres, so steigt zwar die Wärme der letztem um
einige Grade, aber nicht gleichmässig mit dem Wachsen der äus-
sern Temperatur. D untze (exp. calorem animalium spectantia, Lugd.
Bat. 1754.), F obdyce, Banks, Blagden (phil. transact. 1775. v. 65.)
und D e l a r o c h e und B erger haben Versuche hierüber angestellt.
B lagden und Andere hielten mehrere Minuten in einer trocknen
Luft von + 7 9 ° R. aus. D elaroche und Berger beobachteten
hei Kaninchen in einer Temperatur von 50 —90 " Cent, nur ein
Steigen um einige Grade. Auch Vögel setzten sich in hoher äusserer
Temperatur nicht mit dieser ins Gleichgewicht^ sondern
wurden bloss um 6 - 7 ° wärmer. Exp. sur les effets qu une forte
chaleur produit dans l’economie animale. Paris 1806. Journal de
phys. 71. R eil’s Archiv 12. 370. Die Ursache davon liegt in der
durch die Verdunstung stattfindenden Kälteerzeugung. D elaroche
hat dagegen beobachtet, dass Thiere in einer mit Wasserdampfen
überladenen heissen Luft, worin keine Ausdunstung stattfinden
kann, 2 —3, ja selbst 3 — 4° R. wärmer wurden als das
Medium. Hierbei kömmt zugleich die grössere Warmeleitung der
feuchten Luft in Betracht. Man darf übrigens nicht vergessen,
dass die Verstärkung der Verdunstung in trockner Wärme nicht
bloss physikalische Ursachen hat, dass die Wärme liier eine organische
Function anregt. In der Tliat wird die Verdunstung bei
grosser innerer Hitze sehr häufig durch innere Ursachen verhindert,
und in manchen Fiebern ist die Haut nur darum uneiträg-
lich heiss, weil sie trocken und die Ausdunstung verhindert ist.
Den kaltblütigen Thieren hat man häufig eine eigene Temperatur
abgesprochen, was aber nicht statthaft ist. Was zuerst
die Amphibien betrifft, so haben Untersuchungen von J. D avy,
Czermack, W ilford, T iedemann gezeigt, dass die Temperatur dieser
Thiere mit der äussern Temperatur im Allgemeinen bis zu
einem gewissen Punkte sinkt, aber doch die äussere meist um
1 oder mehrerö Grade übertrifft, dass die Temperatur der Amphibien
eben so mit der äussern Temperatur steigt, aber nur bis
zu einem gewissen Punkte stärker als dieselbe ist, bei höheren
Temperaturgraden aber selbst geringer ist. Besonders zahlreich
sind die Versuche von Czermack über die Temperatur der Amphibien.
Baumgaertner’s und E ttinghausen’s Zeitschrift fü r lh y -
sik und Mathematik. 3. Bd. 385.
Bei nackten Amphibien war das Plus der eigenen Tempeia-
tur weniger gross als bei dfen beschuppten Amphibien So war
die Temperatur eines Proteus 14° R. bei 10^ der Luft, 16s
bei 14° der Luft ; 14f° bei 10^° des Wassers. Ein Frosch hatte
7-| ° R. hei 5^° des Wassers, 6 | ° bei 10-t° der Atmosphäre. Die
auffallendsten Unterschiede von mehreren Graden Reaumur fand
Czermack bei Vergleichung der Temperatur der Eidechsen und
Schlangen mit der des Mediums. Vergl. J .D avy, F rorief’s iW . a / 9 .
J D avy fand die Temperatur einer Schlange 31,37(1 C. bei
27 50 der Luft, 32,22 bei 28,30 der Luft, die Temperatur einer
Testudo mydas 28,89 bei 29,55 der Luft, 29,44 bei 30,00 der Luft.
T iedemann beobachtete bei Fröschen eine Temperatur, die
höher als die des Wassers war; als Wasser in der Nacht gefror,
blieb es um den darin befindlichen Frosch ungefroren, und der
Froch hatte + 0,56 0 Temperatur. T iedemann Physiologie I.
Die Versuche von Berthlold (neue Versuche über die lempe-
ratur der kaltblütigen Thiere. Gött. 1835.), welche mit besonde-
M ü l l c r ’s Physiologie. I. ®