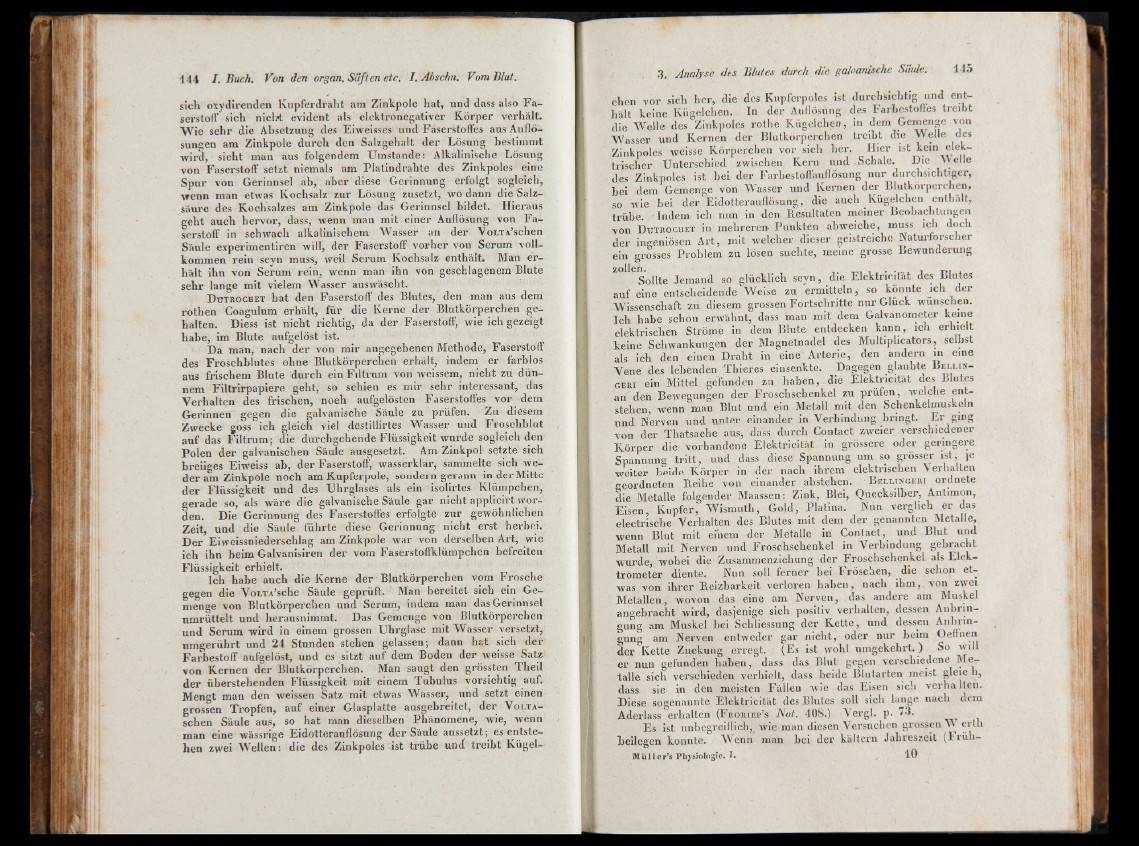
sich oxydirenden Kupferdraht am Zinkpole hat, und dass also Faserstoff
sich nicht evident als elektronegativer Körper verhält.
"Wie sehr die Absetzung des Eiweisses und Faserstoffes aus Auflösungen
am Zinkpole durch den Salzgehalt der Lösung bestimmt
wird, sieht man aus folgendem Umstande: Alkalinische Lösung
von FaserstofF setzt niemals am Platindrahte des Zinkpoles eine
Spur von Gerinnsel ab, aber diese Gerinnung erfolgt sogleich,
wenn man etwas Kochsalz zur Lösung zusetzt, wo dann die Salzsäure
des Kochsalzes am Zinkpole das Gerinnsel bildet. Hieraus
geht auch hervor, dass, wenn man mit einer Auflösung von FaserstofF
in schwach alkalinischem Wasser an der VoLTA’schen
Säule experimentiren will, der FaserstofF vorher von Serum vollkommen
rein seyn muss, weil Serum Kochsalz enthält. Man erhält
ihn von Serum rein, wenn man ihn von geschlagenem Blute
sehr lange mit vielem Wasser auswäScht.
D utkochet bat den FaserstofF des Blutes, den man aus dem
rothen Coagulum erhält, für die Kerne der Blutkörperchen gehalten.
Diess ist nicht richtig, da der Faserstoff, wie ich gezeigt
habe, im Blute aufgelöst ist.
Da man, nach der von mir angegebenen Methode, FaserstofF
des Froschblutes ohne Blutkörperchen erhält, indem er farblos
aus frischem Blute durch ein Filtrum von weissem, nicht zu dünnem
Filtrirpapiere geht, so schien es mir sehr interessant, das
Verhalten des frischen, noeh aufgelösten Faserstoffes vor dem
Gerinnen gegen die galvanische Säule zu prüfen. Zu diesem
Zwecke goss ich gleich viel destillirtes Wasser und Froschblut
auf das Filtrum; die durchgehende Flüssigkeit wurde sogleich den
Polen der galvanischen Säule ausgesetzt. Am Zinkpol setzte sich
breiiges Eiweiss ab, der FaserstofF, wasserklar, sammelte sich weder
am Zinkpole noch am Kupferpole, sondern gerann in der Mitte
der Flüssigkeit und des Uhrglases als ein isolirtes Klümpchen,
gerade so, als wäre die galvanische Säule gar nicht applicirt worden.
Die Gerinnung des Faserstoffes erfolgte zur gewöhnlichen
Zeit, und die Säule führte diese Gerinnung nicht erst herbei.
Der Eiweissniederschlag am Zinkpole war von derselben Art, wie
ich ihn beim Galvanisiren der vom FaserstofFklümpchen befreiten
Flüssigkeit erhielt.
Ich habe auch die Kerne der Blutkörperchen vom Frosche
gegen die VoLTA’sche Säule geprüft. Man bereitet sich ein Gemenge
von Blutkörperchen und Serum, indem man das Gerinnsel
umrüttelt und herausnimmt. Das Gemenge von Blutkörperchen
und Serum wird in einem grossen Uhrglase mit Wasser versetzt,
umgerührt und 24 Stunden stehen gelassen; dann hat sich der
FarbestofF aufgelöst, und es' sitzt auf dem Boden der weisse Satz
von Kernen der Blutkörperchen. Man saugt den grössten Theil
der überstehenden Flüssigkeit mit einem Tubulus vorsichtig auf.
Mengt man den weissen Satz mit etwas Wasser, und setzt einen
grossen Tropfen, auf einer Glasplatte ausgebreitet; der V olta—
sehen Säule aus, so hat man dieselben Phänomene, wie, wenn
man eine wässrige Eidotterauflösung der Säule aussetzt; es entstehen
zwei Wellen: die des Zinkpoles ist trübe unif treibt Kügel—
eben vor sich her, die des Kupferpoles ist durchsichtig und enthält
keine Kügelchen. In der Auflösung des FarhestofFes treibt
die Welle des Zinkpoles rothe Kügelchen, in dem Gemenge von
W7asser und Kernen der Blutkörperchen treibt die Welle des
Zinkpoles weisse Körperchen vor sich her. Hier ist kein elektrischer
Unterschied zwischen Kern und Schale. Die Welle
des Zinkpoles ist bei der FarbestofFauflösung nur durchsichtiger,
bei dem Gemenge von Wasser und Kernen der Blutkörperchen,
so wie bei der Eidotterauflösung, die auch Kügelchen enthält,
trübe. - Indem ich nun in den Resultaten meiner Beobachtungen
von D utkochet in mehreren Punkten abweiche, muss ich doch
der ingeniösen Art, mit welcher dieser geistreiche Naturforscher
ein grosses Problem zu lösen suchte, meine grosse Bewunderung
zollen. t>
Sollte Jemand so glücklich seyn, die Elektricität des Blutes
auf eine entscheidende Weise zu ermitteln, so konnte ich der
Wissenschaft zu diesem grossen Fortschritte nur Glück wünschen.
Ich habe schon erwähnt, dass man mit dem Galvanometer keine
elektrischen Ströme in dem Blute entdecken kann, ich erhielt
keine Schwankungen der Magnetnadel des Multiphcators, selbst
als ich den einen Draht in eine Arterie, den andern in eine
Vene des lebenden Thieres einsenkte. Dagegen glaubte B ellin-
geri ein Mittel gefunden zn haben,, die Elektricität aes Blutes
an den Bewegungen der Froschschenkel zu prüfen, welche entstehen,
wenn man Blut und ein Metall mit den Schenkelmuskeln
und Nerven und unter einander in Verbindung bringt. Er ging
von der Thatsache aus, dass durch Contact zweier verschiedener
Körper die vorhandene Elektricität in grössere oder geringere
Spannung tritt, und dass diese Spannung um so grösser ist, ]e
weiter beide Körper in der nach ihrem elektrischen Verhalten
geordneten Reihe von einander abstehen. ■ Bellingeri ordnete
die Metalle folgender Maassen: Zink, Blei, Quecksilber, Antimon,
Eisen, Kupfer, Wismuth, Gold, Platina. Nun verglich er das
electrische Verhalten des Blutes mit dem der genannten Metalle,
wenn Blut mit einem der Metalle in Contact, und Blut und
Metall mit Nerven und Froschschenkel in Verbindung gebracht
wurde, wobei die Zusammenziehung der FroschschenkeL als Elektrometer
diente. Nun soll ferner bei Fröschen, die schon etwas
von ihrer Reizbarkeit verloren haben, nach ihm,, von zwei
Metallen, wovon das eine am Nerven, das andere am Muskel
angebracht wird, dasjenige sich positiv verhalten, dessen Anbringung
am Muskel bei Schliessung der Kette, und dessen Anbringung
am Nerven entweder gar nicht, oder nur beim OefFnen
der Kette Zuckung erregt. ' (Es ist wohl umgekehrt. ) So will
er nun gefunden haben, dass das Blut gegen verschiedene Metalle
sich verschieden verhielt, dass beide Blutarten meist gleic li,
dass sie in den meisten Fällen wie das Eisen sich verhalten.
Diese sogenannte Elektricität des Blutes soll sich lange nach dem
Aderlass erhalten (F bohiep’s Not. 408.) Vergl. p. 73.
Es ist unbegreiflich, wie man diesen Versuchen grossen M erth
beilegen konnte. Wenn man bei der kältern Jahreszeit (Fiüh-
Müller’s Physiologie. I. 10