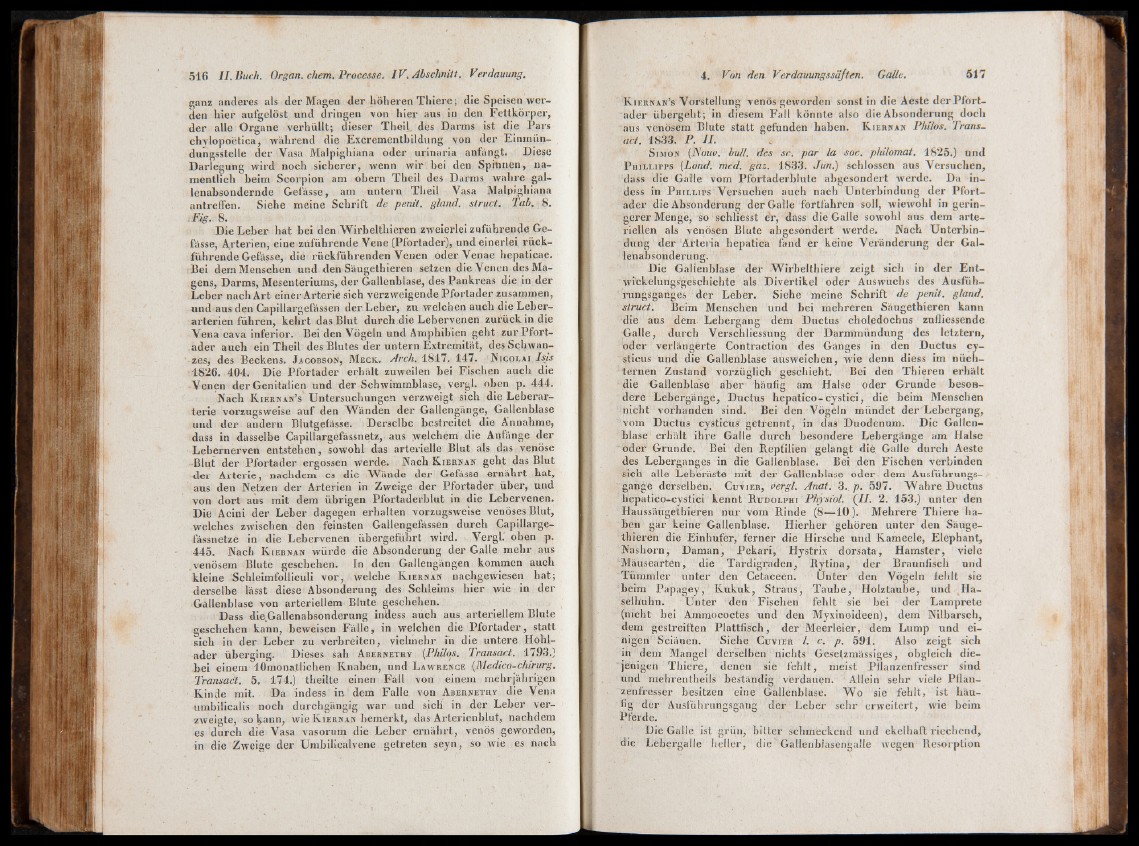
ganz anderes als der Magen der höheren Thiere ; die Speisen werden
hier aufgelöst und dringen von hier aus in den Fettkörper,
der alle Organe verhüllt; dieser Theil. dès Darms ist die Pars
chvlopoetica, während die Excrementbildung von der Einmündungsstelle
der Vasa Malpighiana oder urinaria anfängt. Diese
Darlegung wird noch sicherer, wenn wir hei den Spitiuen, na-
mentlieh beim Scorpion am obern Theil des Darms wahre gal-
lenabsondernde Gelasse, am untern Theil Vasa Malpighiana
antreffen. Siehe meine Schrift de penit. gland, struct. Tab. 8.
■ FiS- 8 .
Die Leber hat bei den Wirbelthieren zweierlei zoführendé Ge-
fässe, Arterien, eine zuführende Vene (Pfortader), und einerlei rück-
führende Gefässe, die rückführenden Venen öder Venae hepaticae.
Bei dem Menschen und den Säugethieren setzen die Venen des Magens,
Darms, Mesenteriums, der Gallenblase, des Pankreas die in der
Leber nach Art einer Arterie sich verzweigende Pfortader zusammen,
und aus den Capillargefässen der Leber, zu welchen auch die Leber-
arterien führen, kehrt das Blut durch die Lebervenen zurück in die
Vena cava inferior. Bei den Vögeln und Amphibien geht-zur Pfortader
auch ein Theil des Blutes der untern Extremität, des Schwanzes,
des Beckens. J acobson, Meck. Arch. 1817. 147. Nicolai Isis
1826. 404. Die Pfortader erhält zuweilen bei Fischen auch die
Venen der Genitalien und der Schwimmblase, vergl. oben p. 444.
Nach K iernan’s Untersuchungen verzweigt sich die Leberarterie
vorzugsweise auf den Wänden der Gallengänge, Gallenblase
und der andern Blutgefässe. Derselbe bestreitet die Annahme,
dass in dasselbe Capillargefassnetz,-aus welchem die Anfänge der
Lebernerven entstehen, sowohl das arterielle Blut als das venöse
Blut der Pfortader ergossen werde. Nach K iernan geht das Blut
der Arterie, nachdem es die Wände der Gefässe ernährt hat,
aus den Netzen der Arterien in Zweige der Pfortader über, und
von dort aus mit dem übrigen Pfortaderblut in die Lebervenen.
Die Acini der Leber dagegen erhalten vorzugsweise venöses Blut,
welches zwischen den feinsten Gallengefässen durch Capillarge-
fässnetze in die Lebervenen übergeführt wird. Vergl.' oben p.
445. Nach K iernan würde die Absonderung der Galle mehr aus
„venösem Blute geschehen. In den Gallengängen kommen auch
kleine Schleimfolliculi vor, welche K iernan nachgewiesen hat;
derselbe lässt diese Absonderung des Schleims hier wie in der
Gallenblase von arteriellem Blute geschehen.
Dass die.Gallenabsonderung indess auch aus arteriellem Blute
geschehen kann, beweisen Fälle, in welchen die Pfortader, statt
sich in der Leber zu verbreiten, vielmehr in die untere Hohlader
überging. Dieses sah Abernethy, {Philos. Transact. 1793.)
bei einem lOmonatlichen Knaben, und L awrence (Medico-chirurg.
Tramact. 5. 174.) theilte einen Fall von einem mehrjährigen
Kinde mit. Da indess in dem Falle von Abernethy die Vena
umbilicalis noch durchgängig war und sich in der Leber verzweigte,
so ^ann, wie K iernan bemerkt, das Arterienblut, nachdem
es durch die Vasa vasorum die Leber ernährt, venös geworden,
in die Zweige der Umbilicalvene getreten seyn, so wie es hach
‘K iernan’s Vorstellung venös geworden sonst in die Aeste der Pfortader
übergeht; in diesem Fall könnte also die Absonderung doch
aus venösem Blute statt gefunden haben. K iernan Philos. Transact.
1833. P. II.
S imon {Noue. bull, dès sc-, par la soc. philomat. 1825.) und
P hillipps {Lond. med. gaz. 1833. Jun.) schlossen aus Versuchen,
dass die Galle vom Pfortaderblute abgesondert werde. Da indess
in P hillips Versuchen auch nach Unterbindung der Pfortader
die Absonderung der Galle fortfahren soll, wiewohl in geringerer
Menge, so schliesst dr, dass die Galle sowohl aus dem arteriellen
als venösen Blute abgesondert werde. Nach Unterbindung
der Ärteiia hepaticä fand er keine Veränderung der Gallenabsonderung.
Die Gallenblase der Wirbelthiere zeigt sich in der Entwickelungsgeschichte
als Divertikel oder Auswuchs des Ausführungsganges
der Leber. Siehe meine Schrift de penit. gland,
struct. Beim Menschen und bei mehreren Säugethieren kann
die aus dem Lebergang dem Ductus choledochus zufliessende
Galle, durch Verschliessung der Darmmündung des letztem,
oder verlängerte Contraction des Ganges in den Ductus cynicus
und die Gallenblase ausweichen, wie denn diess im nüchternen
Zustand vorzüglich geschieht. Bei den Thieren erhält
die Gallenblase aber häufig am Halse oder Grunde besondere
Lebergänge, Ductus hepatico-cystici, die beim Menschen
‘nicht vorhanden sind. Bei den Vögeln mündet der 'Lebergang,
vpm Ductus cysticus getrennt, in das Duodenum. Die Gallenblase
erhält ihre Galle durch besondere Lebergänge am Halse
oder Grunde. Bei den Reptilien gelangt diè. Galle durch Aeste
des Leberganges in die Gallenblase. Bei den Fischen verbinden
sich alle Leberäste mit der Gallenblase oder dem Ausführungs-
gange derselben. Cuvier, vergl. Anat. 3. p. 597. Wahre Ductus
hepatico-cystici kennt R udolphi Phjsiol. (ƒ/. 2. 153.) unter den
Haussäugethieren nur vom Rinde (8—10.). Mehrere Thiere haben
gar keine Gallenblase. Hierher gehören unter den Säugethieren
die Einhufer, ferner die Hirsche und Kameele, Eléphant,
Nashorn, Daman, Pekari, Hystrix dorsata, Hamster, viele
Mäusearten, die Tardigraden, Rytina, der Braunfisch und
Tümmler unter den Cetaceen. Unter den Vögeln fehlt sie
heim Papagey, Kukuk, Straus, Taube, Holztaube, und Haselhuhn.
Unter den Fischen fehlt sie bei der Lamprete
(nicht bei Ammococtes und den Myxinoideen), dem Nilbarsch,
dem gestreiften Plattfisch, der Meerleier, dem Lump und einigen
Sciänen. Siehe Cuvier l. c. p. 591. Also zeigt sich
in dem Mangel derselben nichts Geselzmässiges, obgleich diejenigen
Thiere, denen sie fehlt, meist Pflanzenfresser sind
und mehrentheils beständig verdauçn. Allein sehr viele Pflanzenfresser
besitzen eine Gallenblase. Wo sie fehlt, ist häufig
der Ausführungsgaug der Leber sehr erweitert, wie beim
Pferde.
Die Galle ist grün, bitter schmeckend und ekelhaft riechend,
die Lebergalle heller, die Gallenbiasengalle wegen Resorption