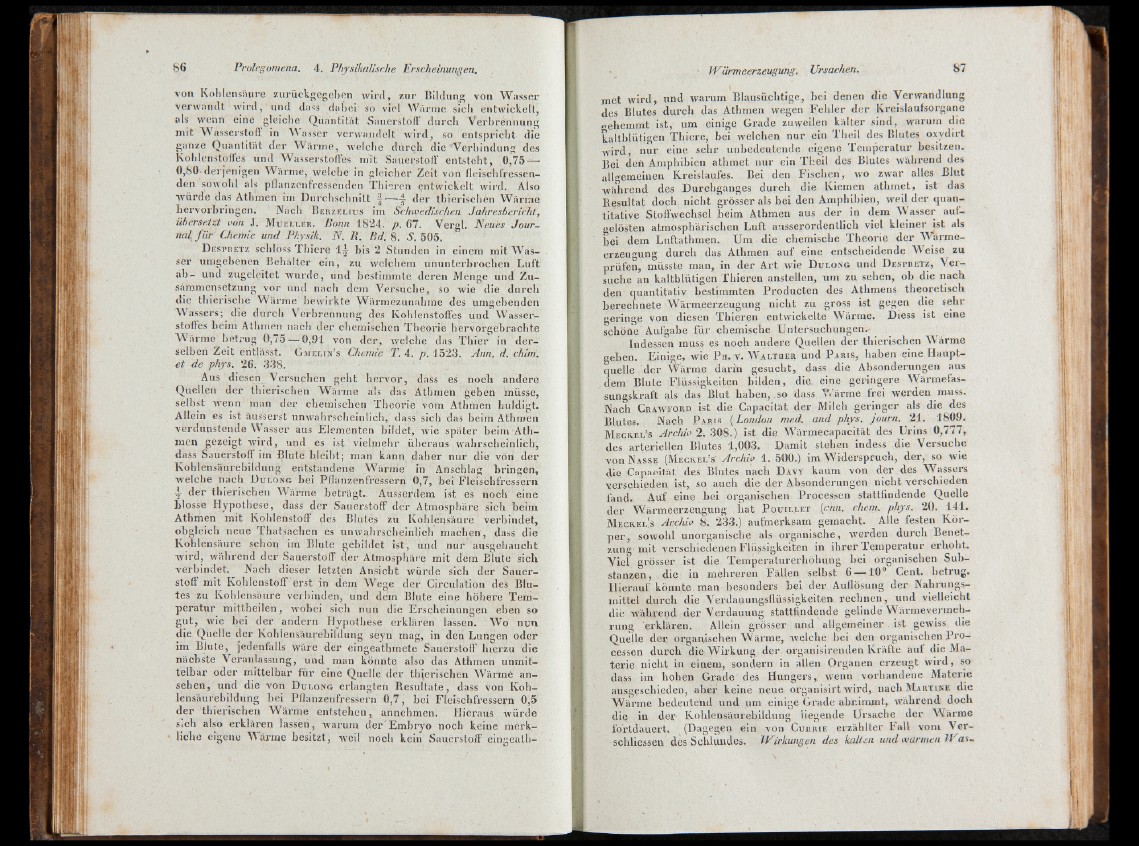
von Kohlensäure zurückgegeben wird, zur Bildung von Wasser
verwandt wird, und dass dabei so viel Wärme sich entwickelt,
als wenn eine gleiche Quantität Sauerstoff durch Verbrennung
mit Wasserstoff in Wasser verwandelt wird, so entspricht die
ganze Quantität der Wärme, welche durch die ^Verbindung des
Kohlenstoffes und Wasserstoffes mit Sauerstoff entsteht, 0,75 —
0,80- derjenigen Wärme, welche in gleicher Zeit von fleischfressenden
sowohl als pflanzenfressenden Thieren entwickelt wird. Also
wurde das Athmen im Durchschnitt ——jr der thierischen Wärme
hervorhringen. Nach Berzelius im Schwedischen Jahresbericht,
übersetzt von J. Mueli.er. Bonn 1824. p. 67. Vergl. Neues Journal,
fü r Chemie und Physik. N. R. Bd. 8 . S. 505.
D espretz schloss Thiere 1^- bis 2 Stunden in einem mit Wasser
umgebenen Behälter ein, zu welchem ununterbrochen Luft
ab- und zugeleitet wurde, und bestimmte deren Menge und Zu-
sämmensetzung vor und nach dem Versuche, so wie die durch
die thierische Wärme bewirkte Wärmezunahme des umgehenden
Wassers; die durch Verbrennung des Kohlenstoffes und Wasserstoffes
beim Athmen nach der chemischen Theorie hervorgebrachte
Wärme betrug 0,75 — 0,91 von der, welche das Thier in derselben
Zeit entlässt. G melin’s Chemie T. 4. p. 1523. Ann, d. chim.
et de phys. 26. 338.
Aus diesen Versuchen geht hervor, dass es noch andere
Quellen der thierischen Wärme als das Athmen geben müsse,
selbst wenn man der chemischen Theorie vom Athmen huldigt.
Allein es ist äusserst unwahrscheinlich, dass sich das beim Athmen
verdunstende Wasser aus Elementen bildet, wie später beim‘Athmen
gezeigt wird, und es ist vielmehr überaus wahrscheinlich,
dass Sauerstoff im Blüte bleibt; man kann daher nur die von der
Kohlensäurebildung entstandene Wärme in Anschlag bringen,
welche nach D ulong bei Pflanzenfressern 0,7, bei Fleischfressern
■i der thierischen Wärme beträgt. Ausserdem ist es noch eine
blosse Hypothese, dass der Sauerstoff de‘r Atmosphäre sich beim
Athmen mit Kohlenstoff des Blutes zu Kohlensäure verbindet,
obgleich neue Thatsachen es unwahrscheinlich machen, dass die
Kohlensäure schon im Blute gebildet ist, und nur ausgehaucht
wird, während der Sauerstoff der Atmosphäre mit dem Blute sich
verbindet. Nach dieser letzten Ansicht würde sich der Sauerstoff
mit Kohlenstoff erst in dem Wege der Circulätion des Blutes
zu Kohlensäure verbinden, und dem Bjute eine höhere Temperatur
mittheilen, wobei sich nun die Erscheinungen eben so
gut, wie bei der andern Hypothese erklären lassen. Wo nun
die Quelle der Kohlensäurebildung sCyn mag, in den Lungen oder
im Blute, jedenfalls Wäre der eingeathmete Sauerstoff hierzu die
nächste Veranlassung, und man könnte also das Athmen unmittelbar
oder mittelbar für eine Quelle der thierischen Wärme an-
sehen, und die von D ulong erlangten Resultate, dass von Kohlensäurebildung
bei Pflanzenfressern 0,7, bei Fleischfressern 0 ,5
der thierischen Wärme entstehen, annehmen. Hieraus würde
smh also erklären lassen, warum der'Embryo noch keine merkliche
eigene Wärme besitzt, weil noch kein Sauerstoff eingeathmet
wird, und warum Blausüchtige, bei denen die Verwandlung
des Blutes durch das Athmen wegen Fehler der Kreislaufsorgane
«ehemmt ist, um einige Grade zuweilen kälter sind, warum die
kaltblütigen Thiere, bei welchen nur ein Theil des Blutes oxydirt
wird, nur eine sehr unbedeutende eigene Temperatur besitzen.
Bei deft Amphibien athmet nur ein Theil des Blutes während des
allgemeinen Kreislaufes. Bei den Fischen, wo zwar alles Blut
während des Durchganges durch die Kiemen athmet, ist das
Resultat doch nicht grösser als bei den Amphibien, weil der quantitative
Stoffwechsel beim Athmen aus der in dem Wasser aufgelösten
atmosphärischen Luft ausserordentlich viel kleiner ist als
bei dem Luftathmen. Um die chemische Theorie der Wärmeerzeugung
durch das Athmen auf eine entscheidende Weise zu
prüfen, müsste man, in der Art wie D ulong und D espretz, Versuche
an kaltblütigen Thieren anstelleu, um zu sehen, ob die nach
den quantitativ bestimmten Producten des Athmens theoretisch
berechnete Wärmeerzeugung nicht zu gross ist gegen die sehr
geringe von diesen Thieren entwickelte Wärme. Diess ist eine
schöne Aufgabe für chemische Untersuchungen.-
Indessen muss es noch andere Quellen der thierischen Wärme
geben. Einige, wie P h. v. W alther und P aris, haben eine Hauptquelle
der \Värme darin gesucht, dass die Absonderungen aus
dem Blute Flüssigkeiten bilden, die eine geringere Wärmefassungskraft
als das Blut haben, .so dass Wärme frei werden muss.
Nach Crawford ist die Capacität der Milch geringer als die des
Blutes. Nach P aris (London med. and phys. journ. 21. 1809.
M eckel’s Archiv 2, 308.) ist die Wärmecapacität des Urins 0,777,
des arteriellen Blutes 1,003. Damit stehen indess die Versuche
von Nasse (Meckel’s Archiv 1. 500.) im W iderspruch, der, so wie
die Capacität des Blutes nach D avy kaum von der des Wassers
verschieden ist, so auch die der Absonderungen nicht verschieden
fand. Auf eine bei organischen Processen stattfindende Quelle
der Wärmeerzeugung hat P ouillet [pnn. ehern, phys. 20. 141.
M eckelJs Archiv 8 ., 233.) aufmerksam gemacht. Alle festen Körper,
sowohl unorganische als organische, werden durch Benetzung
mit verschiedenen Flüssigkeiten in ihrer Temperatur erhöht.
Viel grösser ist die Temperaturerhöhung bei organischen Substanzen,
die in mehreren Fällen selbst 6 —10° Cent, betrug.
Hierauf könnte man besonders bei der Auflösung der Nahrungsmittel
durch die Verdauungsflüssigkeiten rechnen, und vielleicht
die während der Verdauung stattfindende gelinde Wärmevermehrung
erklären. Allein grösser und allgemeiner ist gewiss die
Quelle der organischen Wärme, welche bei den organischen Processen
durch die Wirkung der organisirenden Kräfte auf die Materie
nicht in einem, sondern in allen Organen erzeugt wird, so
dass im hohen Grade des Hungers, wenn vorhandene Materie
ausgeschieden, aber keine neue organisirt wird, nach Martine die
Wärme bedeutend und um einige Grade abnimmt, während doch
diq in der Kohlensäurebildung liegende Ursache der Wärme
förtdaüert. (Dagegen ein von Currie erzählter Fall vom Ver-
schliessen, des Schlundes. Wirkunsen des kalten und warmen Was