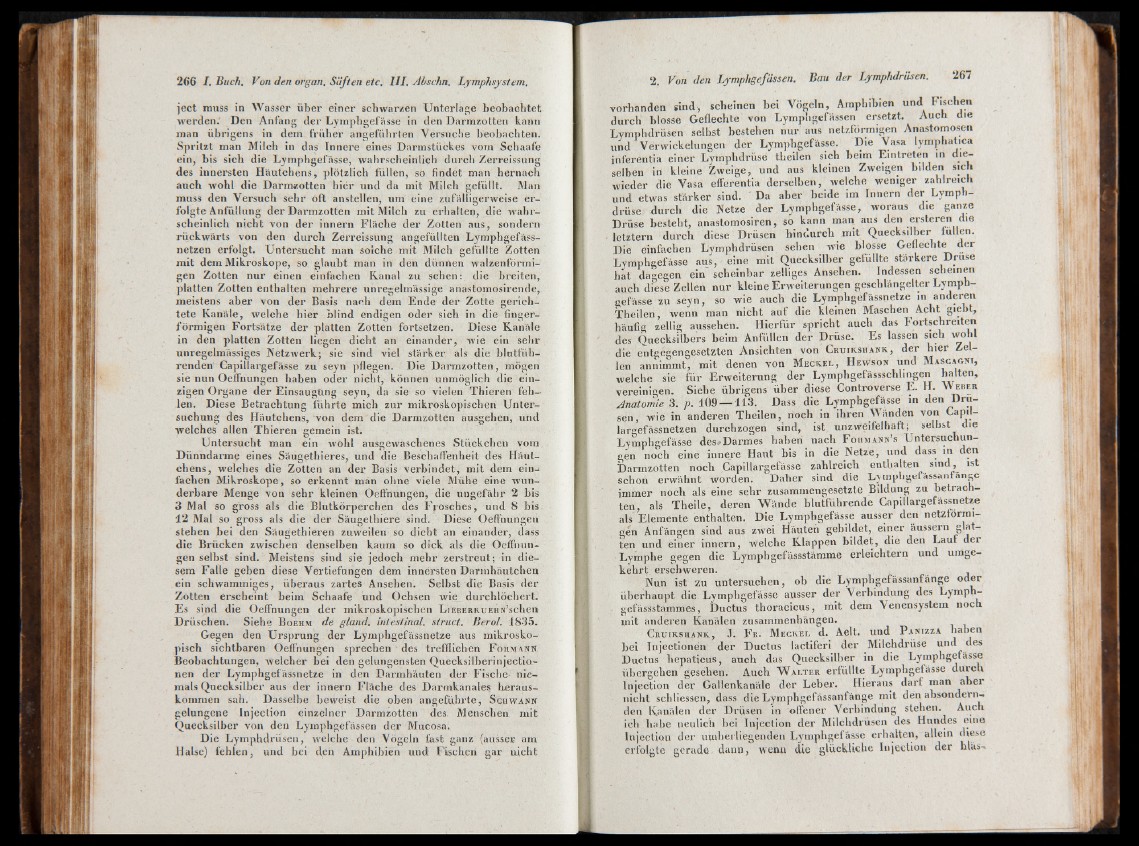
ject muss in Wasser über einer schwarzen Unterlage beobachtet
werden.' Den Anfang der Lyrnphgefässe in den Darmzotten kann
man übrigens in dem früher angeführten Versuche beobachten.
Spritzt man Milch in das Innere eines Darmstückes vom Schaafe
ein, bis sich die Lyrnphgefässe, wahrscheinlich durch Zerreissung
des innersten Häutchens, plötzlich füllen, so findet man hernach
auch wohl die Darmzotten hiér und da mit Milch gefüllt. Man
muss den Versuch sehr oft anstellen, um eine zufälligerweise erfolgte
Anfüllung der Darmzotten mit Milch zu erhalten, die wahrscheinlich
nicht von der innern Fläche der Zotten aus, sondern
rückwärts von den durch Zerreissung angefüllten Lymphgefäss-
netzen erfolgt. Untersucht man solche mit Milch gefüllte Zotten
mit dem Mikroskope, so glaubt man in den dünnen walzenförmigen
Zotten nur einen einfachen Kanal zu sehen: die breiten,
platten Zotten enthalten mehrere unregelmässige anastomosirende,
meistens aber von der Basis nach dem Ende der Zotte gerichtete
Kanäle, welche hier blind endigen oder sich in die fingerförmigen
Fortsätze der platten Zotten fortsetzen. Diese Kanäle
in den platten Zotten liegen dicht an einander, wie ein sehr
unregelmässiges Netzwerk; sie sind viel stärker als die blutführenden
Capillargefässe zu seyn pflegen. Die Darmzotten, mögen
sie nun Oetfnungen haben oder nicht, können unmöglich die einzigen
Organe der Einsaugung seyn, da sie so vielen Thieren fehlen.
Diese Betrachtung führte mich zur mikroskopischen Untersuchung
des Häutchens, von dem die Darmzotten ausgehen, Und
welches allen Thieren gemein ist.
Untersucht man ein wohl ausgewaschenes Stückchen vom.
Dünndarme eines Säugethieres, und die Beschaffenheit des Häutchens,
welches die Zotten an der Basis verbindet, mit dem ein-*
fachen Mikroskope, so erkennt man ohne viele Mühe eine wunderbare
Menge von sehr kleinen Oeffnungen, die ungefähr 2 bis
3 Mal so gross als die Blutkörperchen des Frosches, und 8 bis
12 Mal so gross als die der Säugetliiere sind. Diese Oeffnungen
stehen bei den Säugethieren zuweilen so dicht an einander, dass
die Brücken zwischen denselben kaum so dick als die Oeffnungen
selbst sind. Meistens sind sie jedoch mehr zerstreut!;'-in diesem
Falle geben diese Vertiefungen dem innérsten Darinhäutchen
ein schwammiges, überaus zartes Ansehen. Selbst die Basis der
Zotten erscheint beim Schaafe und Ochsen wie durchlöchert.
Es sind die Oeffnungen der mikroskopischen LiEBERKUEHN’schen
Dröschen. Siehe Boehm de gland. intestinal, struct. Berol. 1835.
Gegen den Ursprung der Lymphgefässnetze aus mikroskopisch
sichtbaren Oeffnungen sprechen • des treffliehen F ohmann.
Beobachtungen, welcher bei den gelungensten Queeksilberinjectia-
nen der Lymphgefässnetze in den Darmhäuten der Fische: niemals
Quecksilber aus der innern Fläche des Darmkanales herauskommen
sah. Dasselbe beweist die oben angeführte, Schwann
gelungene Injection einzelner Darmzotten des. Menschen mit
Quecksilber von den Lymphgefässen der Mucosa.
Die Lymphdrüsen, welche den Vögeln fast ganz (ausser am
Halse) fehlen, und bei den Amphibien und Fischen gar uicht
vorhanden sind, scheinen bei Vögeln, Amphibien und
durch blosse Geflechte von Lymphgefässen ersetzt. Auch die
Lymphdrüsen selbst bestehen nur aus netzförmigen Anastomosen
und Verwickelungen der Lyrnphgefässe. Die Vasa lymphatica
inferentia einer Lymphdrüse theilen sich beim Eintreten in dieselben
in kleine Zweige, und aus kleinen Zweigen bilden sich
wieder die Vasa efferentia derselben, welche weniger zahlreich
und etwas stärker sind. Da aber beide im Innern der Lymphdrüse
durch die Netze der Lyrnphgefässe, woraus die ganze
Drüse besteht, anästomosiren, so kann man aus den ersteren die
letztem durch diese Drüsen hindurch mit Quecksilber füllen.
Die einfachen Lymphdrüsen sehen wie blosse Geflechte der
Lyrnphgefässe aus, eine mit Quecksilber gefüllte stärkere Druse
hat dagegen ein scheinbar zeitiges Ansehen. Indessen scheinen
auch diese Zellen nur kleine Erweiterungen geschlängelter Lymph-
gefässe zu seyn, so wie auch die Lymphgefässnetze in anderen
Theilen, wenn man nicht auf die kleinen Maschen Acht giebt,
häufig zellig aussehen. Hierfür spricht auch das Fortschreiten
des Quecksilbers beim Anfüllen der Drüse. Es lassen sich wohl
die entgegengesetzten Ansichten von Cruikshank, der hier Zellen
annimmt,{ mit denen von Meckel, Hewson und Mascagni,
welche sie für Erweiterung der Lymphgefässschlingen halten,
vereinigen. Siehe übrigens über diese Controverse E. H. W eber
Anatomie 3. p. 109 — 113. Dass die Lyrnphgefässe in den Drusen,
wie in anderen Theilen, noch in ihren Wänden von Capi-
largefässnetzen durchzogen sind, ist unzweifelhaft; selbst die
Lyrnphgefässe des#Darmes haben nach F ohmann’s Untersuchungen
noch eine innere Haut bis in die Netze, und dass in den
Darmzotten noch Capillargefässe zahlreich enthalten sind, ist
schon erwähnt worden. Daher sind die Lytnphgefässanfänge
immer noch als eine sehr zusammengesetzte Bildung zu betrachten,
als Theile, deren Wände blutführende Capillargefässnetze
als'Elemente enthalten. Die Lyrnphgefässe ausser den netzförmigen
Anfängen sind aus zwei Häuten gebildet, einer äussern S itten
und einer innern, welche Klappen bildet, die den Lauf der
Lymphe gegen die Lymphgefässstämme erleichtern und umgekehrt
erschweren.
Nun ist zu untersuchen, ob die Lympbgefässanfänge oder
überhaupt die Lyrnphgefässe ausser der Verbindung des Lymph-
gefässstammes, Ductus thoracicus, mit dem Venensystem noch
mit anderen Kanälen Zusammenhängen.
Cruikshank, J. F r. Meckel d. Aelt. und P anizza haben
bei Injectionen der Ductus lactiferi der Milchdrüse und des
Ductus liepaticus, auch das Quecksilber in die Lyrnphgefässe
übergehen gesehen. Auch W alter erfüllte Lyrnphgefässe durch
Injection der Gallenkan'äle der Leber, Hieraus darf man aber
nicht schliessen, dass die Lymphgefässanfänge mit den absondernden
Kanälen der Drüsen in offener Verbindung stehen. Auch
ich habe neulich bei Injection der Milchdrüsen des Hundes eine
Injection der umherliegenden Lyrnphgefässe erhalten, allein diese
erfolgte gerade dann, wenn die glückliche Injection der blas-«