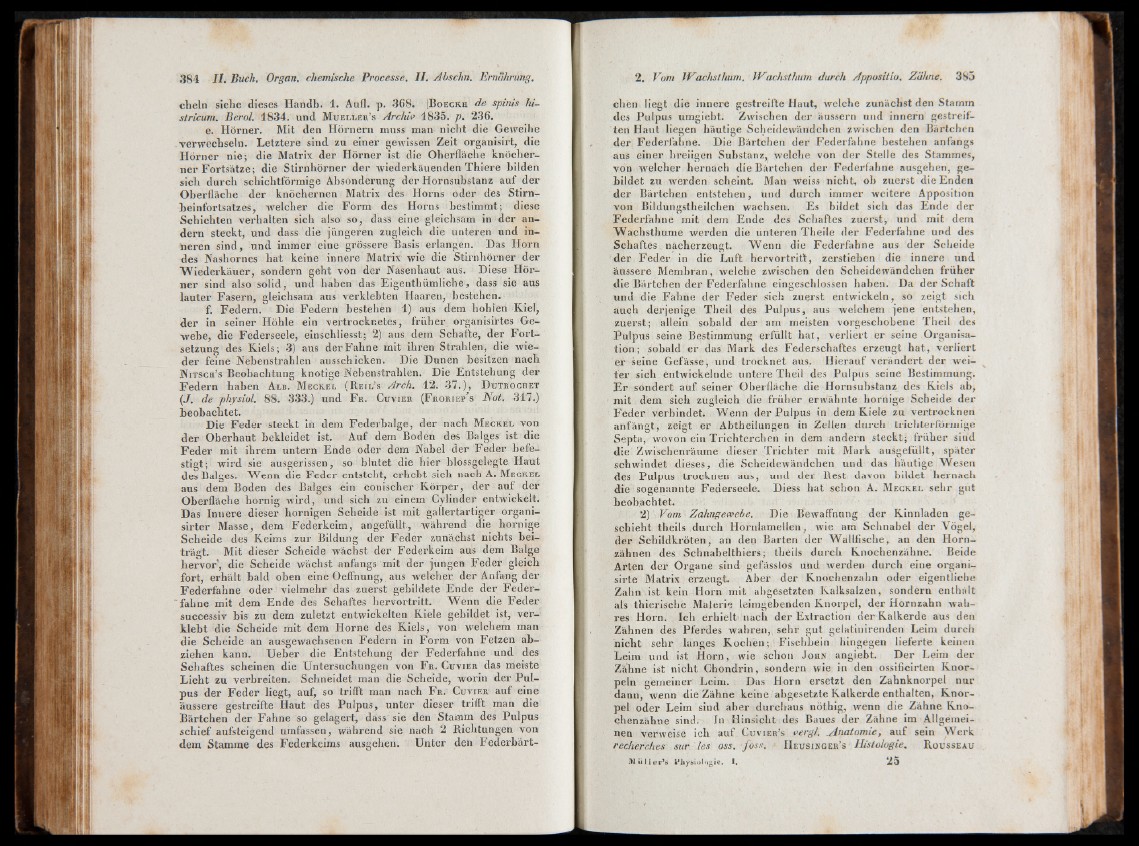
clieln siehe dieses Handb. 1. Aufl. p. 368. [Boeckh de spinis hi-
stricum. Berol. 1834. und Mueller’s Archiv 1835. p. 236.
e. Hörner. Mit den Hörnern muss man nicht die Geweihe
verwechseln. Letztere sind zu einer gewissen Zeit organisirt, die
Hörner nie; die Matrix der Hörner ist die Oberfläche knöcherner
Fortsätze; die Stirnhörner der wiederkäuenden Thiere bilden
sich durch schichtförmige Absonderung der Hornsubstanz auf der
Oberfläche der knöchernen Matrix des Horns oder des Stirnheinfortsatzes,
welcher die Form des Horns bestimmt; diese
Schichten verhalten sich also so, dass eine gleichsam in der andern
steckt, und dass die jüngeren zugleich die unteren und inneren
sind, und immer eine grössere Basis erlangen. Das Horn
des Nashornes hat keine innere Matrix' wie die Stirnhörner der
Wiederkäuer, sondern geht von der Nasenhaut aus. Diese Hörner
sind also solid, und haben das Eigentümliche, dass sie aus
lauter Fasern, gleichsam aus verklebten Haaren, bestehen.
f. Federn. Die Federn bestehen 1) aus dem hohlen Kiel,
der in seiner Höhle ein vertrocknetes, früher organisirtes Gewebe,
die Federseele, einschliesst; 2) aus dem Schafte, der Fortsetzung
des Kiels; 3) aus der Fahne mit ihren Strahlen, die wieder
feine Nebenstrahlen ausschicken. Die Dunen besitzen nach
N i t s c h ’s Beobachtung knotige Nebenstrahlen. Die Entstehung der
Federn haben Alb. Meckel (R eil’s Arch. 12. 37.), D utrochet
(J. de physiol. 88. 333.) und F r. Cuvier (Froriep’s Not, 317.)
beobachtet.
Die Feder steckt in dem Federbalge, der nach Meckel von
der Oberhaut bekleidet ist. Auf dem Boden des Balges ist die
Feder mit ihrem untern Ende oder dem Nabel der Feder befestigt;
wird sie ausgerissen, so blutet die hier blossgelegte Haut
des Balges. Wenn die Feder entsteht, erhebt sich nach A. Meckel
aus dem Boden des Balges ein conischer Körper, der auf der
Oberfläche hornig wird, und sich zu einem Cylinder entwickelt.
Das Innere dieser hornigen Scheide ist mit gallertartiger organi-
sirter Masse, dem Federkeim, angefüllt, während die hornige
Scheide des Keims zur Bildung der Feder zunächst nichts beiträgt.
Mit dieser Scheide wächst der Federkeim aus dem Balge
hervor, die Scheide wächst anfangs mit der jungen Feder gleich
fort, erhält bald oben eine Oeifnung, aus welcher der Anfang der
Federfahne oder vielmehr das zuerst gebildete Ende der Federfahne
mit dem Ende des Schaftes hervortritt. Wenn die Feder
successiv bis zu dem zuletzt entwickelten Kiele gebildet ist, verklebt
die Scheide mit dem Horne des Kiels, von welchem man
die Scheide an ausgewachsenen Federn in Form von Fetzen ab-
ziehen kann. Ueber die Entstehung der Federfahne und des
Schaftes scheinen die Untersuchungen von F r. Cuvier das meiste
Licht zu verbreiten. Schneidet man die Scheide, worin der Pul-
pus der Feder liegt, auf, so trifft man nach F r. Cuvier auf eine
äussere gestreifte Haut des Pulpus, unter dieser trifft man die
Bärtchen der Fahne so gelagert, dass sie den Stamm des Pulpus
schief aufsteigend umfassen, während sie nach 2 Richtungen von
dem Stamme des Federkeims ausgehen. Unter den Federbärteben
liegt die innere gestreifte Haut, welche zunächst den Stamm
des Pulpus umgiebt. Zwischen der äussern und innern gestreiften
Haut liegen häutige Scheidewändchen zwischen den Bärtchen
der Federfahne. Die Bärtchen der Federfahne bestehen anfangs
aus einer breiigen Substanz, welche von der Stelle des Stammes,
von welcher hernach die Bärtchen der Federfahne ausgehen, gebildet
zu werden scheint. Man weiss nicht, oh zuerst die Enden
der Bärtchen entstehen, und durch immer weitere Apposition
von Bildungstheilcben wachsen. Es bildet sich das Ende der
Federfahne mit dem Ende des Schaftes zuerst, und mit dem
Wachsthume werden die unteren Theile der Federfahne und des
Schaftes. nächerzeugt. Wenn die Federfahne aus der Scheide
der Feder in die Luft hervortritt, zerstieben die innere und
äussere Membran, welche zwischen den Scheidewändchen früher
die Bärtchen der Federfahne eingeschlossen haben. Da der Schaft
und die Fahne der Feder sich zuerst entwickeln, so zeigt sich
auch derjenige Theil des Pulpus, aus weichem jene entstehen,
zuerst; allein sobald der am meisten vorgeschobene Theil des
Pulpus seine Bestimmung erfüllt hat, verliert er seine Organisation;
sobald er das Mark des Federschaftes erzeugt hat, verliert
er seine Gefässe, und trocknet aus. Hierauf verändert der weiter
sich entwickelnde untere Theil des Pulpus seine Bestimmung.
Er sondert auf. seiner Oberfläche die Hornsubstanz des Kiels ah,
mit dem sich zugleich die früher erwähnte hornige Scheide der
Feder verbindet. Wenn der Pulpus in dem Kiele zu vertrocknen
anfängt, zeigt er Abtheilungen in Zellen durch trichterförmige
Septa, wovon ein Trichterchen in dem andern steckt; früher sind
die Zwischenräume dieser Trichter mit Mark ausgefüllt, später
schwindet dieses, die Scheidewändchen und das häutige Wesen
des Pulpus trocknen aus, und der Rest davon bildet hernach
die sogenannte Federseele. Diess hat schon A. Meckel sehr gut
beobachtet.
;2)' Vom Zahngewebe. Die Bewaffnung der Kinnladen geschieht
theils durch Hornlamellen, wie am Schnabel der Vögel,
der Schildkröten, an den Barten der Wallfische, an den Hornzähnen
des Schnabelthiers; theils durch Knochenzähne. Beide
Arten der Organe sind gefässlos und werden durch eine organi-
sirte Matrix erzeugt. Aber der Knochenzahn oder eigentliche
Zahn ist kein Horn mit abgesetzten Kalksalzen, sondern enthält
als thierische Materie leimgebenden Knorpel, der Hornzahn wahres
Horn. Ich erhielt'nach der Extraction der Kalkerde aus den
Zähnen des Pferdes wahren,, sehr gut gelatinirenden Leim durch
nicht sehr langes Kochen; Fischbein hingegen lieferte keinen
Leim und ist Horn, wie schon J ohn angiebt. Der Leim der
Zähne ist nicht Ghondrin, sondern wie in den ossificirten Knorpeln
gemeiner Leim. Das Horn ersetzt den Zahnknorpel nur
dann, wenn die Zähne keine abgesetzte Kalkerde enthalten, Knorpel
oder Leim sind aber durchaus nöthig, wenn die Zähne Knochenzähne
sind. In Hinsicht des Baues der Zähne im Allgemeinen
verweise ich auf Cuvier’s vergl, .Anatomie, auf sein Werk
recherches sur 'les oss. foss. H eusinger’s Histologie. R ousseau
Wiiller’s PJiysioliigie. 1. 25