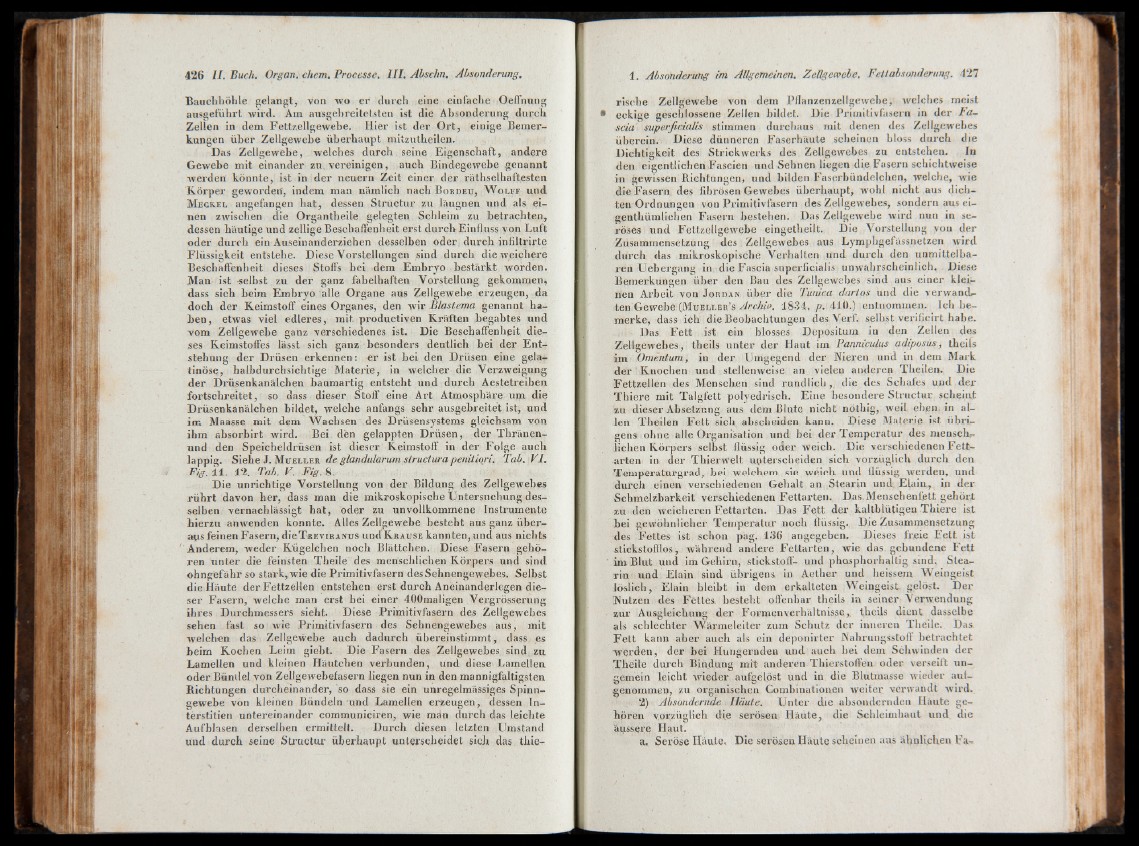
Bauchhöhle gelangt, von wo er durch eine einfache Oeffnung
ausgeführt wird. Am ausgebreitetsten ist die Absonderung durch
Zellen in dem Fettzellgewebe. Hier ist der Ort, einige Bemerkungen
über Zellgewebe überhaupt mitzutheilen.
Das Zellgewebe, welches durch seine Eigenschaft, andere
Gewebe mit einander zu, vereinigen, auch Bindegewebe genannt
werden könnte, ist in der neuern Zeit einer der räthselhaftesten
Körper geworden, indem man nämlich nach Bordeu, W olff und
Meckel angefangen hat, dessen Structur zu läugnen und als einen
zwischen die Organtheile gelegten Schleim zu betrachten,
dessen häutige und zellige Beschaffenheit erst durch Einfluss von Luft
oder durch ein Auseinanderziehen desselben oder, durch infiltrirte
Flüssigkeit entstehe. Diese Vorstellungen sind durch die weichere
Beschaffenheit dieses Stoffs bei dem Embryo bestärkt worden.
Man ist -selbst zu der ganz fabelhaften Vorstellung gekommen,
dass sich heim Embryo alle Organe aus Zellgewebe erzeugen, da
doch der Keimstoff eines Organes, den wir Blastema genannt haben,
etwas viel edleres, mit productiven Kräften begabtes und
vom Zellgewebe ganz verschiedenes ist. Die Beschaffenheit dieses
Keimstoffes lässt sich ganz besonderes deutlich bei der Entstehung
der Drüsen erkennen: er ist hei den Drüsen eine gelatinöse,
halbdurchsichtige Materie, in Welcher die Verzweigung
der Drüsenkanälchen baumartig entsteht und durch Aestetreiben
fortschreitet, so dass dieser Stoff eine Art Atmosphäre um die
Drüsenkanälchen bildet, welche anfangs sehr ausgebreitet ist, und
im Maasse mit dem Wachsen des Drüsensystems gleichsam von
ihm absorbirt wird. Bei den gelappten Drüsen, der Thränen-
und den Speicheldrüsen ist dieser Keimstoff in der Folge auch
lappig. Siebe J. Mujeixer de glandularum structura penitiori. Tab. VI.
Fig. 11. 12. Tab. V. Fig. 8.,
Die unrichtige Vorstellung von der Bildung des Zellgewebes
rührt davon her, dass man die mikroskopische Untersuchung desselben
vernachlässigt hat, öder zu unvollkommene Instrumente
hierzu anwenden konnte. Alles Zellgewebe besteht aus ganz überaus
feinen Fasern, die T reviranus und K rause kannten, und aus nichts
Anderem, weder Kügelchen noch Blättchen. Diese Fasern gehören
unter die feinsten Theile des menschlichen Körpers und sind
ohngefähr so stark, wie die Primitivfasern des Sehnengewebes. Selbst
die Häute derFettzellen entstehen erst durch Aneinanderlegen dieser
Fasern, welche man erst bei einer 400maligen Vergrösserung
ihres Durchmessers sieht. Diese Primitivfasern des Zellgewebes
sehen fast so wie Primitivfasern des Sehnengewebes aus, mit
welchen das Zellgewebe auch dadurch übereinstimmt, dass, es
heim Kochen Leim giebt. Die Fasern des Zellgewebes sind zu
Lamellen und kleinen Häutchen vei’bunden, und diese-Lamellen
oder Bündel von Zellgewebefasern liegen nun in den mannigfaltigsten
Bichtungen durcheinander, so dass sie ein unregelmässiges Spinngewebe
von kleinen Bündeln -und Lamellen erzeugen, dessen Tn-
terstitien untereinander communiciren, wie män durch das leichte
Aufblasen derselben ermittelt. Durch diesen letzten Umstand
Und durch seine Structur überhaupt unterscheidet sich das thierische
Zellgewebe von dem Pflanzenzellgewebe, welches meist
eckige geschlossene Zellen bildet. Die Primitivfasern in der Fa-
scia superficialis stimmen durchaus mit denen des Zellgewebes
überein. Diese dünneren Faserhäute scheinen bloss durch die
Dichtigkeit des Strickwerks des Zellgewebes zu entstehen. In
den eigentlichen Fascien und Sehnen liegen die Fasern schichtweise
in gewissen Richtungen, und bilden Faserbündelchen, welche, wie
die Fasern des fibrösen Gewebes überhaupt, wohl nicht aus dichten
Ordnungen von Primitivfasern des Zellgewebes, sondern aus ei-
genthümliehen Fasern bestehen. Das Zellgewebe wird nun in seröses
und Fettzellgewebe eingetheilt. Die Vorstellung von der
Zusammensetzung des Zellgewebes aus Lymphgefässnetzen wird
durch das mikroskopische Verhalten und durch den unmittelbaren
Uebei’gang in die Fascia superficialis unwahrscheinlich. Diese
Bemerkungen über den Bau des Zellgewebes sind aus einer kleinen
Arbeit von J ordan über die Tunica dartos und die verwandten
Gewebe (Mueller’s 1834. p. 410.) entnommen. Ich bemerke,
dass ich die Beobachtungen des Verf. seihst verifieirt habe.
Do* Fett ist ein blosses Depositum in den Zellen des
Zellgewebes, theils unter der Haut im Panniculus adiposus, theils
im Omentum, in der Umgegend der Nieren und in dem Mark
der Knochen und stellenweise an vielen anderen Theilen. Die
Fettzellen des Menschen sind rundlich, die des Schafes und der
Thiere mit Talgfett polyedrisch. Eine besondere Structur scheint
zu dieser Absetzung aus dem Blute nicht nöthig, weil eben, in allen
Theilen Fett sich abscheiden kann. Diese Materie ist übrigens
söhne alle Organisation und bei der Temperatur des menschlichen
Körpers selbst flüssig oder weich. Die verschiedenen Fettarten
in der Thierwelt unterscheiden sich vorzüglich durch den
Temperaturgrad, bei welchem sie weich und flüssig werden, und
durch einen verschiedenen Gehalt an Stearin und. Elain, in der
Schmelzbarkeit verschiedenen Fettarten. Das.Menschenfett gehört
zu den weicheren Fettarten. Das Fett der kaltblütigen Thiere ist
bei gewöhnlicher Temperatur noch flüssig.. Die Zusammensetzung
des Fettes ist schon pag. 136 angegeben. Dieses freie Fett ist
stickstofflos, während andere Fettarten, wie das. gebundene Fett
im Blut und im Gehirn, Stickstoff- und phosphorhaltig sind. Stearin
und Elain sind übrigens in Aether und heissem Weingeist
löslich, Elain bleibt in dem erkalteten Weingeist, gelöst. Der
Nutzen des Fettes, besteht offenbar theils in seiner Verwendung
zur Ausgleichung der Formenverhältnisse,. theils dient dasselbe
als schlechter Wärmeleiter zum Schutz der inneren Theile. Das.
Fett kann aber auch als ein deponirter Nahrungsstoff betrachtet
werden, der bei Hungernden und auch hei dem Schwinden der
Theile durch Bindung mit- anderen Thierstoffen oder verseilt un-
gemein leicht Avieder aufgelöst und in die Blutmasse Avieder auf-
genommen, zu organischen Combinationen Aveiter. verAvandt wird.
2) Absondernde Häute. Unter die absondernden Häute gehören
vorzüglich die serösen Häute, die Schleimhaut und die
äussere Haut.
a. Seröse Häute. Die serösen Häute scheinen aus ähnlichen Fa