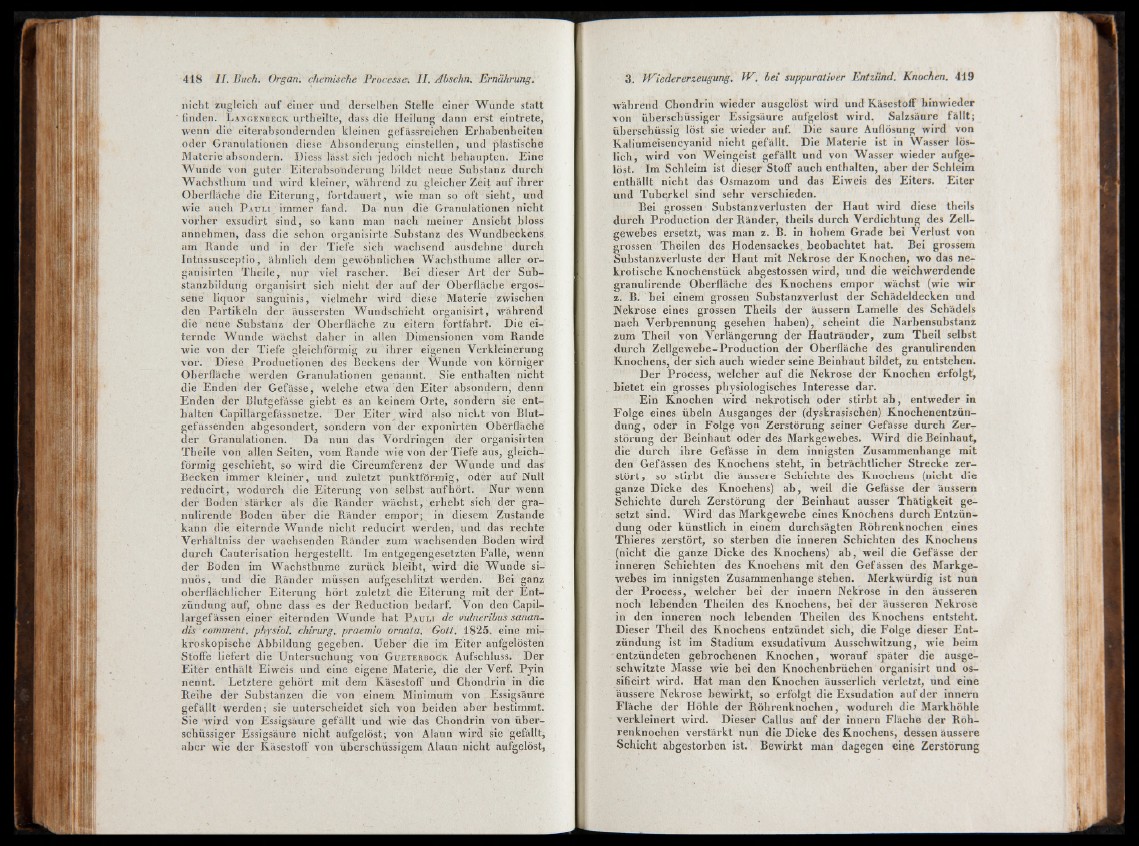
nicht zugleich auf einer und derselben Stelle einer Wunde statt
finden. L angenbeck urtheilte, dass die Heilung dann erst eintrete,
wenn die eiterabsondernden kleinen gefässreichen Erhabenheiten
oder Granulationen diese Absonderung einstellen, und plastische
Materie absondern. Diess lasst sich jedoch nicht behaupten. Eine
Wunde von guter Eiterabsonderung bildet neue Substanz durch
Wachsthum und wird kleiner, während zu gleicher Zeit auf ihrer
Oberfläche die Eiterung, fortdauert, wie man so oft sieht, und
wie auch P auli; immer fand. Da nun die Granulationen nicht
vorher exsudir.t -sind, so kann man nach meiner Ansicht bloss
annehmen, dass die schon organisirte Substanz des Wundbeckens
am Rande und in der Tiefe sich wachsend ausdehne durch
Intussusceptio, ähnlich dem gewöhnlichen Wachsthume aller or-
ganisirten Theile, nur viel rascher. Bei dieser Art der Substanzbildung
organisirt sich nicht der auf der Oberfläche ergossene
liquor sanguinis, vielmehr wird diese Materie zwischen
den Partikeln der äussersten Wundschicht organisirt, während
die neue Substanz der Oberfläche zu eitern fortfährt. Die eiternde
Wunde wächst daher in allen Dimensionen vom Rande
wie von der Tiefe gleichförmig zu ihrer eigenen Verkleinerung
vor. Diese Productionen des Beckens der Wunde von körniger
Oberfläche werden Granulationen genannt. Sie enthalten nicht
die Enden der Gefässe, welche etüa den Eiter absoiidern, denn
Enden der Blutgefässe giebt es an keinem Orte, sondern sie enthalten
Capillargefässnetze. Der Eiter wird also nicht von Blutgefässenden
abgesondert, sondern von der exporiirten Oberfläche
der Granulationen. Da nun das Vordringen der organisirten
Theile von allen Seiten, vom Rande wie von der Tiefe aus, gleichförmig
geschieht, so wird die Circumferenz der Wunde und das
Becken immer kleiner, und zuletzt punktförmig, oder auf Null
reducirt, wodurch die Eiterung von selbst aufhört. Nur wenn
der Boden stärker als die Ränder wächst, erhebt sich der gra-
nulirende Boden über die Ränder, empor; in diesem Zustande
kann die eiternde Wunde nicht reducirt werden, und das rechte
Verhältniss der wachsenden Ränder zum wachsenden Boden wird
durch Cauterisation he’rgestellt. Im entgegengesetzten Falle, wenn
der Boden im Wachsthume zurück bleibt, wird die Wunde si-
nuös, und die Ränder müssen aufgesclditzt werden. Bei ganz
oberflächlicher Eiterung hört zuletzt die Eiterung mit der Entzündung
auf, ohne dass es der Reduction bedarf. Von den Capil-
largefässen einer eiternden Wunde hat P auli de vulneribus sanan-
dis comment. physiol. chirurg. praemio ornata. Gott. 1825. eine mikroskopische
Abbildung gegeben, lieber die im Eiter aufgelösten
Stoffe liefert die Untersuchung von Gueterbock. Aufschluss. Der
Eiter enthält Eiweis, und eine eigene Materie, die der Verf. Pyin
nennt. Letztere gehört mit dem Käsestoff und Ch'ondrin in die
Reihe der Substanzen die von einem Minimum von Essigsäure
gefällt werden; sie unterscheidet sich von beiden aber bestimmt.
Sie wird von Essigsäure gefällt und wie das Chondrin von überschüssiger
Essigsäure nicht aufgelöst; von Alaun wird sie gefällt,
aber wie der Käsestoff von überschüssigem Alaun nicht aufgelöst,
während Chondrin wieder ausgelöst wird und Käsestoff hinwieder
von überschüssiger Essigsäure aufgelöst wird. Salzsäure fällt;
überschüssig löst sie wieder auf. Die saure Auflösung wird von
Kaliumeisenöyanid nicht gefällt. Die Materie ist in Wasser löslich,
wird von Weingeist gefällt und von Wasser wieder aufgelöst.
Im Schleim ist dieser Stoff auch enthalten, aber der Schleim
enthällt nicht das Osmazom und das Eiweis des Eiters. Eiter
und Tuberkel sind sehr verschieden.
Bei grossen Substanzverlusten der Haut wird diese theils
durch Production der Ränder, theils durch Verdichtung des Zellgewebes
ersetzt, was man z. B. in hohem Grade bei Verlust von
grossen Theilen des Hodensackes, beobachtet hat. Bei grossem
Substanzverluste der Haut mit Nekrose der Knochen, wo das nekrotische
Knochenstück abgestossen wird, und die weichwerdende
granulirende Oberfläche des Knochens empor wächst (wie wir
z. B. bei einem grossen Substanzverlust der Schädeldecken und
Nekrose eines grossen Theils der äussern Lamelle des Schädels
nach Verbrennung gesehen haben), scheint die Narbensubstanz
zum Theil von Verlängerung der Hautränder, zum Theil selbst
durch Zellgewebe-Production der Oberfläche des granulirenden
Knochens, der sich auch wieder seine Beinhaut bildet, zu entstehen.
Der Process, welcher auf die Nekrose der Knochen erfolgt,
hietet ein grosses physiologisches Interesse dar.
Ein Knochen wird nekrotisch oder stirbt ab, entweder in
Folge eines Übeln Ausganges der (dyskrasischen) Knochenentzündung,
oder in Folge von Zerstörung seiner Gefässe durch Zerstörung
der Beinhaut oder des Markgewebes. Wird die Beinhaut,
die durch ihre Gefässe in dem innigsten Zusammenhänge mit
den Gefässen des Knochens steht, in beträchtlicher Strecke zerstört,
so stirbt die äussere Schichte des Knochens (nicht die
ganze Dicke des Knochens) ab, weil die Gefässe der äussern
Schichte durch Zerstörung der Beinhaut ausser Thätigkeit gesetzt
sind. Wird das Markgewebe eines Knochens durch Entzündung
oder künstlich in einem durchsägten Röhrenknochen eines
Thieres zerstört, so sterben die inneren Schichten des Knochens
(nicht die ganze Dicke des Knochens) ab, weil die Gefässe der
inneren Schichten des Knochens mit den Gefässen des Markgewebes
im innigsten Zusammenhänge stehen. Merkwürdig ist nun
der Process, welcher bei der innern Nekrose in den äusseren
noch lebenden Theilen des Knochens, bei der äusseren Nekrose
in den inneren noch lebenden Theilen des Knochens entsteht.
Dieser Theil des Knochens entzündet sich, die Folge dieser Entzündung
ist im Stadium exsudativum Ausschwitzung, wie beim
entzündeten gebrochenen Knochen, worauf später die ausgeschwitzte
Masse wie bei den Knochenbrüchen organisirt und os-
sificirt wird. Hat man den Knochen äusserlich verletzt, und eine
äussere Nekrose bewirkt, so erfolgt die Exsudation auf der innern
Fläche der Höhle der Röhrenknochen, wodurch die Markhöhle
verkleinert wird. Dieser Gallus auf der innern Fläche der Röhrenknochen
verstärkt nun die Dicke des Knochens, dessen äussere
Schicht abgestorben ist. Bewirkt man dagegen eine Zerstörung