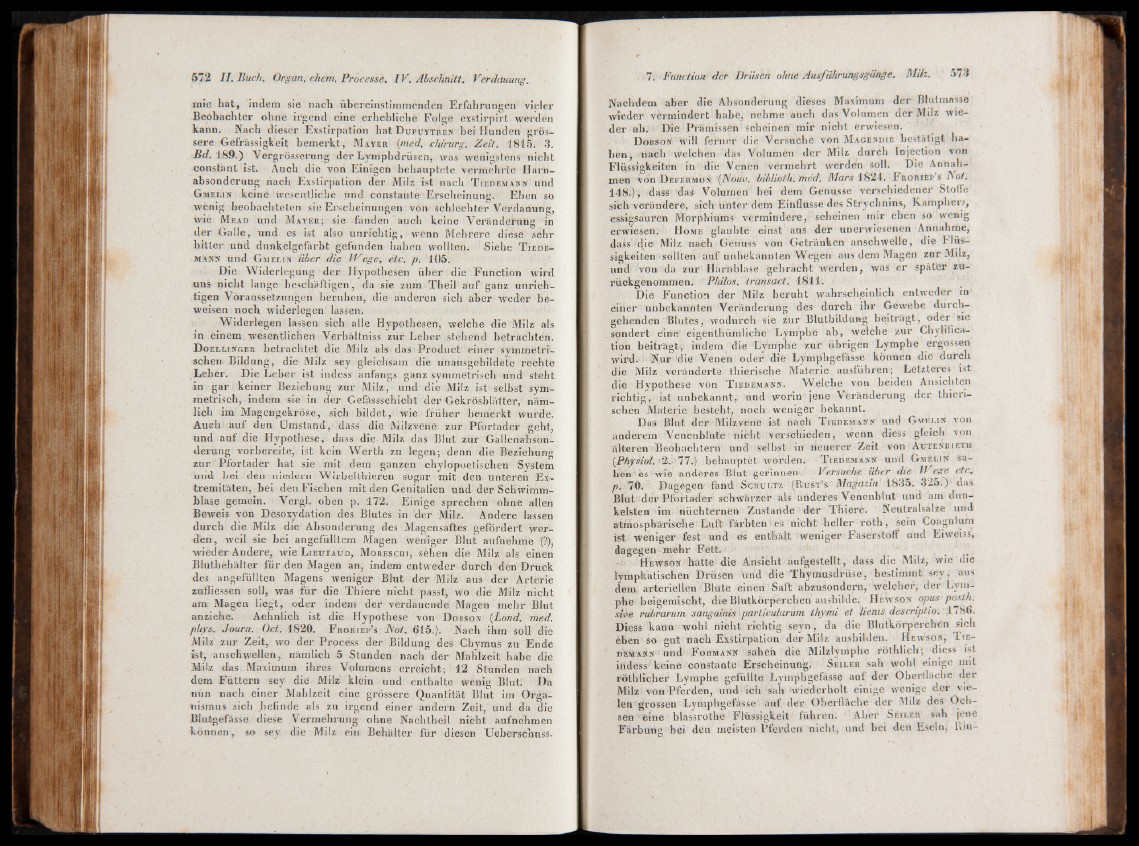
mie hat, indem sie nach übereinstimmenden Erfahrungen vieler
Beobachter ohne irgend eine erhebliche Folge exstirpirt werden
kann. Nach dieser Exstirpation hat D upuytren hei Hunden grössere
Gefrässigkeit bemerkt, M ayer (med. chirurg. Zeit. 1815. 3.
Bd. 189.) Verg rösserung der Lymphdrüsen, was wenigstens nicht
constant ist. Auch die von Einigen behauptete vermehrte Harnabsonderung
nacli Exstirpation der Milz ist nach T iedemann und
G melin keine wesentliche und constante Erscheinung. Eben sö
wenig beobachteten sie Erscheinungen von schlechter Verdauung,
wie Mead und Mayer; sie fanden auch keine Veränderung in
der Galle, und- es ist also unrichtig, wenn Mehrere diese sehr
bitter und dunkelgefärbt gefunden haben wollten. Siehe T iede-
männ und Gmelin über die IVege, etc. p. '105.
Die Widerlegung der Hypothesen über die Function wird
uns nicht lange beschäftigen, da sie zum Theil auf ganz unrichtigen
Voraussetzungen beruhen, die anderen sich aber weder beweisen
noch widerlegen lassen.
Widerlegen lassen sich alle Hypothesen, welche die Milz als
in einem, wesentlichen Verhältniss zur Leber stehend betrachten.
D oellinger betrachtet die Milz als das Product einer symmetrischen'
Bildung, die Milz sey gleichsam die unausgebildete rechte
Leber. Die Leber ist indess anfangs ganz symmetrisch und steht
in gar keiner Beziehung zur Milz, und die Milz ist selbst symmetrisch,
indem sie in der Gefässschicht der Gekrösblätter, nämlich
im Magengekröse, sich bildet, wie früher bemerkt wurde.
Auch auf den Umstand, dass die Milzvene zur Pfortader geht,
und auf die Hypothese, dass die Milz das Blut zur Gallenabsonderung
vorbereite, ist kein Werth zu legen; denn die Beziehung
zur Pfortader hat sie mit dem ganzen chylopoetisehen System
und bei den niedern Wirbeltbieren sogar mit den unteren Extremitäten,
hei den Fischen mit den Genitalien und der Schwimmblase
gemein. Vergl. oben p. 172. Einige sprechen ohne allen
Beweis von Desoxydation des Blutes in der Milz. Andere lassen
durch die Milz die Absonderung des Magensaftes gefördert werden,
weil sie bei angefülltem Magen weniger Blut aufnehme '(?),
wieder Andere, wie L ieutaud, Moreschi, sehen die Milz als einen
Blutbehälter für den Magen an, indem entweder durch den Druck
des angefüllten Magens weniger Blut der Milz aus der Arterie
zufliessen soll, was für die Thiere nicht passt, wo die Milz nicht
am Magen liegt, oder indem der verdauende Magen mehr Blut
anziehe. Aehnlich ist die Hypothese von Dobson (Land. med.
phys, Journ. Oct. 1820. F roriep’s Not. 615.). Nach ihm soll die
Milz zur Zeit, wo der Process der Bildung des Cbymus zu Ende
ist, anschwellen, nämlich 5 Stunden nach der Mahlzeit habe die
Milz das Maximum ihres Volumens erreicht; 12 Stunden nach
dem Füttern sey die Milz klein und enthalte wenig Blut. Da
nun nach einer Mahlzeit eine grössere Quantität Blut im Organismus
sich befinde als zu irgend einer andern Zeit, und da die
Blutgefässe diese Vermehrung ohne Nachtheil nicht aufnehmen
können, so sey die Milz ein Behälter für diesen Ueberschuss.
Nachdem aber die Absonderung dieses Maximum der ßlutmasse
wieder vermindert habe, nehme auch das Volumen der Milz wieder
ab. Die Prämissen scheinen mir nicht erwiesen.
D obsoN will ferner die Versuche von Magendie bestätigt haben,
nach welchen das Volumen der Milz durch Injection von
Fl üssigkeiten in die Venen vermehrt werden soll. Die Annahmen
von D epermön. (Nouo. bddioth. med. Mars 1824. F rorieps ISot.
148*), dass das Volumen bei dem Genüsse verschiedener Stoffe
sich verändere, sich unter dem Einflüsse des Strychnins, Kamphers,
essigsauren Morphiums' vermindere, scheinen mir eben so wenig
erwiesen. H ome glaubte einst aus der unerwiesenen Annahme,
dass d,ie; Milz nach Genuss von Getränken anschwelle, die bliis-
sigkeiten sollten auf unbekannten Wegen aus dem Magen zur Milz,
und von da zur Harnblase gebracht werden, was er später zurückgenommen.
Philos. transact. 1811.
Die Function der Milz beruht wahrscheinlich entweder in
einer unbekannten Veränderung des durch ihr Gewebe durchgehenden
Blutes, wodurch sie zur Blutbildung beiträgt, oder sie
sondert eine eigenthümliche Lymphe ab, welche zur Chylifica-
tiou beiträgty indem die Lymphe zur übrigen Lymphe ergossen
wird. Nur die Venen oder die Lymphgefässe können die durch
die Milz veränderte thierische Materie ausführen; Letzteres ist
die Hypothese von T iedemann. Welche von beiden Ansichten
richtig, ist unbekannt, und worin jene Veränderung der thieri-
schen Materie besteht, noch weniger bekannt.
Das Blut der Milzvene ist nach T iedemann und G melin von
anderem Venenblute nicht verschieden, wenn diess gleich von
älteren iBeobachtern und selbst in neuerer Zeit von A u t e n r i e t u
(Physiol.j2.;'77.) behauptet wórden. T iedemann und G melin sahen'é
s 'wie anderes Blut gewinnen. Versuche über die Wege etc.
p. 70. Dagegen fand ■ SfcnÜLTz ' (Rtjst’s '• Magazin 1835. 325.) das
Blut1 der Pfortader schwärzer als anderes Venenblut und am dunkelsten
im nüchternen Zustande der Thiere. Neutralsalze und
atmosphärische' Luft färbten 1 es nicht heller roth, sein Coagnlum
ist Weniger fest und es enthält weniger Faserstoff und Eiweiss,
dagegen mehr Fett.
H ewson hatte die Ansicht aufgestellt, dass die Milz, wie die
lymphatischen Drüsen und die Thymusdrüse, bestimmt sey, aus
dem arteriellen Blüte einen Saft abzusondern, welcher, der Lymphe
beigemischt, die Blutkörperchen ausbilde. H ewson opus posih.
sive rubrarum sanguinis particularum thymi et liems descriptio. 1 /8 6 .
Diess kann wohl nicht richtig seyn, da die Blutkörperchen sich
ében so gut nach Exstirpation der Milz ausbilden. H ewson, T iedemann
■ und F ohmann sahen die Milzlymphe röthlich; diess ist
indess'keine constante Erscheinung. S eiler sah wohl einige mit
röthlicher Lymphe gefüllte Lymphgefässe aut der Oberfläche der
Milz von Pferden, und ich sab wiederholt einige wenige der vielen'grossen
Lymphgefässe auf der Oberfläche der Milz des Ochsen
eine blassrothe Flüssigkeit führen. Aber S eiler sah jene
Färbung bei den meisten Pferden nicht, und bei den Eseln, Lin