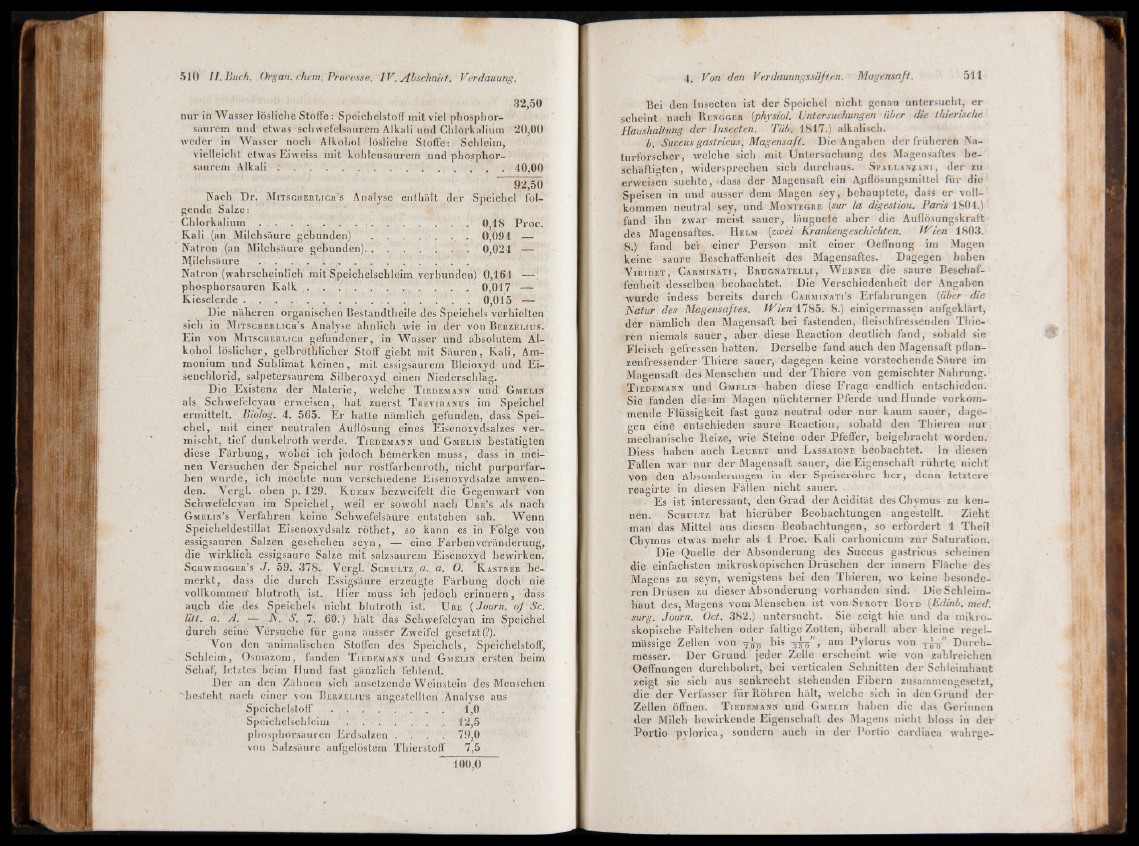
32.50
nur in Wasser lösliche Stoffe: Speichelstoff mit viel phosphorsaurem
und etwas schwefelsaurem Alkali und Chlörkalium 20,00
weder in Wasser noch Alkohol lösliche Stoffe: Schleim,
vielleicht etwas Eiweiss mit kohlensaurem und phosphor-
saurem Alkali . ....................................................... ..... 40,00
92.50
Nach Dr. Mitscherlich’s Analyse enthält der Speichel folgende
Salze:
Chlorkalium . . . . . . . .............................. .... 0,18 Proc.
Kali (an Milchsäure gebunden) ......................... .... 0,094' —
Natron (an Milchsäure gebunden). , . . . . . 0,024 —
IWIIchsäure . . . . . . . . . . . . . .
Natron (wahrscheinlich mit Speichelschleim verbunden) 0,164 —;
phosphorsauren K a lk .................................. . . . 0,017 —-
Kieselerde..................... . . . . . . . . . 0,015 —
Die näheren organischen Bestandtheile des Speichels verhielten
sich in Mitscherlich’s Analyse ähnliche wie in der von Berzelius.
Ein von Mitscherlich gefundener, 'in Wasser und absolutem Alkohol
löslicher, gelbröthiicher Stoff giebt mit Säuren, Kali, Ammonium
und Sublimat keinen, mit essigsaurem Bleioxyd und Ei-
senchlorid, salpetèrsaurem Silberoxyd einen Niedèrsehlag.
Die Existenz der Materie, welche T iedemann und Gmelin
als Schwefelcyan erweisen, hat zuerst T reviramus im Speichel
ermittelt. Biolog. 4. 565. Er hatte nämlich gefunden, dass. Speichel,
mit einer neutralen Auflösung eines Eisenoxydsalzes vermischt,
tief dunkelroth werde. T iedemann und G melin bestätigten
diese Färbung, wobei ich jedoch bemerken muss," dass in riiei-
nen Versuchen der Speichel Bur rostfarbenroth, nicht purpurfarben
wurde, ich mochte nun verschiedene Eisenoxydsalze anwenden.
Vergl. oben p. 129. K uehn bezweifelt die Gegenwart von
Schwefelcyan im Speichel, weil er sowohl nach U re’s als nach
G melin’s Verfahren kein'e Schwefelsäure entstehen sah. Wenn
Speicheldestillat Eisenoxydsalz röthet, so kann es in Folge von
essigsauren Salzen geschehen seyn, — eine Farbenve’ränderüng,
die wirklich essigsaure Salze mit salzsäurem Eisenoxyd bewirken.
S chweigger’s J. 59. 378. Vergl. S chultz a. a. 0. K a.stmer bé-
merkt, dass die durch Essigsäure erzeugte Färbung doch' nie
vollkommen' blutroth^ ist. Hier muss ich jedoch erinnern, dass
auch die des Speichels nicht blutroth istl U re ( Journ. oj Sc.
litt. a. A. - N. S. ,7. 60.) hält das Schwefelcyan im Speichel
durch seine Versuche für ganz ausser Zweifel gesetzt'?).
Von den ‘animalischen Stoffen des Speichels, Speichelstoff,
Schleim, Osmazom, fanden T iedemamn und G melin ersten beim
Schaf, letztes beim Hund fast gänzlich fehlend.
Der an den Zähnen sich ansetzende Weinstein des Menschen
■'besteht nach einer von Berzelius angestelllen Analyse aus
Speichelstoff ...........................................1,0
Speichelschleim.........................12,5
phosphorsauren Erdsalzen . . . . 79,0
von Salzsäure aufgelöstem Thierstoff 7,5
Bei den Insecten ist der Speichel nicht genau untersucht, er
scheint nach Rengger (physiol. Untersuchungen über die thierische
Haushaltung der Insecten. Tüb. 1817.) alkalisch.
b. Succus gastricus, Magensaft. Die Angaben der früheren Naturforscher,
welche sich mit Untersuchung des Magensaftes beschäftigten,
widersprechen sich durchaus. Spallanzani, der zu
erweisen suchte, 'dass der Magensaft ein Auflösungsmittel für die
Speisen in und ausser dem Magen sey, behauptete, dass er vollkommen
neutral sey, und Montegre (sur la digestion. Paris 1804.)
fand ihn zwar meist sauer, läugnete aber die Auflösungskraft
des Magensaftes. Helm (zwei Krankengeschichten. Wien 1803.
8 .) fand bei einer Person mit einer Oeffnung im Magen
keine saure Beschaffenheit des Magensaftes. Dagegen haben
ViRiDET, Carminati, Brugnatelli , Werner die saure Beschaffenheit
desselben beobachtet. Die Verschiedenheit der Angaben
wurde indess bereits durch Carminati’s Erfahrungen (über die
Natur des Magensaftes. Wien 1785. 8 .) einigermassen aufgeklärt,
der nämlich den Magensaft bei fastenden, fleischfressenden Thie-
ren niemals sauer, aber,diese Reaction deutlich fand, sobald sie
Fleisch gefressen hatten. Derselbe fand auch den Magensaft pflanzenfressender
Thiere sauer, dagegen keine vorstechende Säure im
Magensaft des Menschen und der Thiere von gemischter Nahrung.
Tiedemann und Gmelin haben diese Frage endlich entschieden.
Sie fanden die»im Magen nüchterner Pferde und Hunde vorkom-
niende Flüssigkeit fast ganz neutral oder nur kaum sauer, dagegen
eine entschieden saure Reaction, sobald den Thieren nur
mechanische Reize, wie Steine oder Pfeffer, beigebracht worden.
Diess haben auch Leuret und Lassaigne beobachtet. In diesen
Fällen war nur der Magensaft sauer, die Eigenschaft rührte nicht
von den Absonderungen in der Speiseröhre her, denn letztere
reagirte in diesen Fällen nicht sauer.
KÉ Es ist interessant, den Grad der Acidität desChymus zu kennen.
Schultz hat hierüber Beobachtungen angestellt. Zieht
man das Mittel aus diesen Beobachtungen, so erfordert 1 Theil
Chymus etwas mehr als 1 Proc. Kali carbonicum zur Saturation.
Die Quelle der Absonderung des Succus gastricus scheinen
die einfachsten mikroskopischen DrüSchen der innern Fläche des
Magens zu seyn, wenigstens bei den Thieren, w’o keine besonderen
Drüsen zu dieser Absonderung vorhanden sind. Die Schleimhaut
des. Magens vom Menschen ist von Sprott Boyd (Edinb. med.
surg. Journ. Oct. 382.) untersucht. Sie zeigt hie und da mikroskopische
Fältchen oder faltige Zotten, überall aber kleine regelmässige
Zellen von ^(jr bis yg-ö", am Pylorus von Durchmesser.
Der Grund jeder Zelle erscheint wie von zahlreichen
Oeffnungen durchbohrt, bei verticalen Schnitten der Schleimhaut
zeigt sie sich aus senkrecht stehenden Fibern zusammengesetzt,
die der Verfasser für Röhren hält, welche sich in den Grund der
Zellen öffnen. Tiedemann und Gmelin haben die das Gerinnen
der Milch bewirkende Eigenschaft des Magens nicht bloss in der
Portio pylorica, sondern auch in der Portio cardiaca wahrge