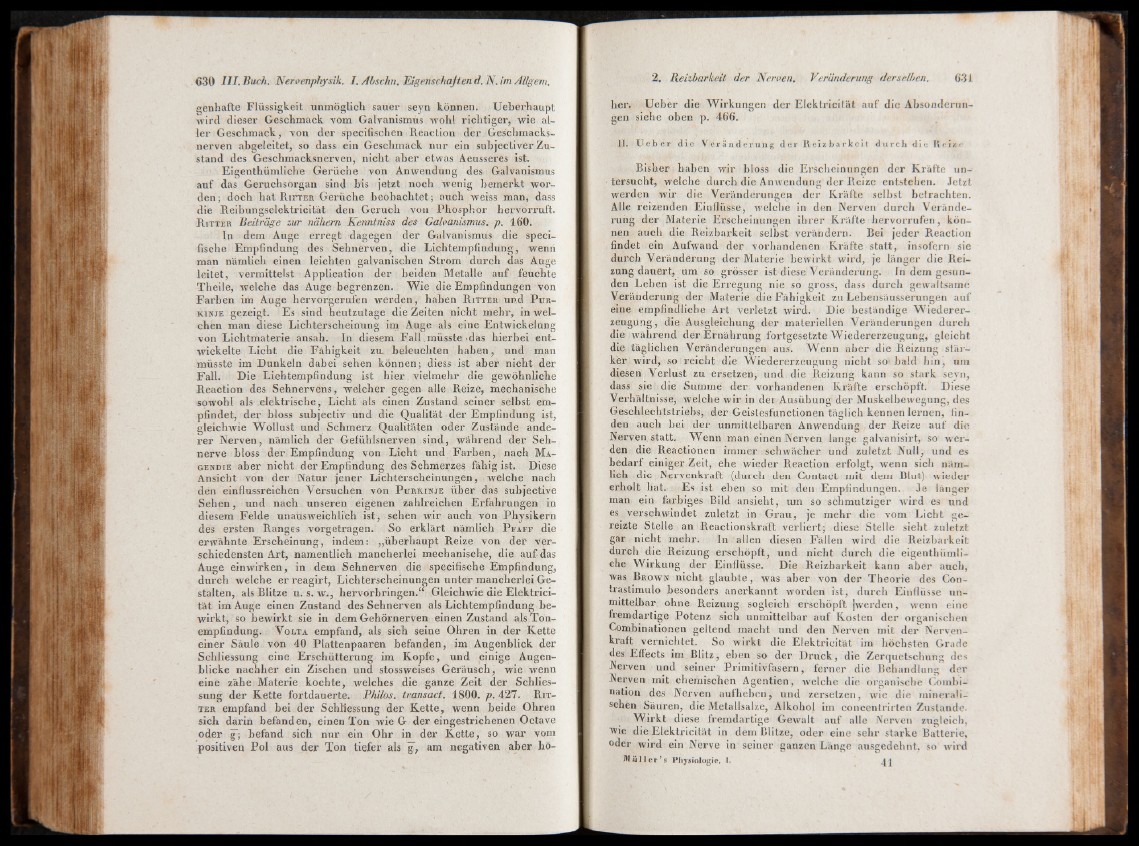
genliafte Flüssigkeit unmöglich sauer seyn können. Ueberhaupt
wird dieser Geschmack vom Galvanismus wohl richtiger, wie aller
Geschmack, von der specifischen Reaction der Ges'chmacks-
nerven abgeleitet, so dass ein Geschmack nur ein subjectiver Zustand
des Geschmacksnerven, nicht aber etwas Aeusseres ist.
Eigenthümliche Gerüche von Anwendung des Galvanismus
auf das Geruchsorgan sind bis jetzt noch wenig bemerkt worden;
doch hat R ifter Gerüche beobachtet; auch weiss man, dass
die Reibungselektricität den Geruch von-Phosphor hervörruft.
R itter Beiträge zur nähern Kenntniss des Galpanismus. p. 160.
In dem Auge erregt dagegen der Galvanismus die speci-
fische Empfindung des Sehnerven, die Lichtempfiadung, wenn
man nämlich einen leichten galvanischen Strom durch das Auge
leitet, vermittelst Application der beiden Metalle auf feuchte
Theile, welche das Auge begrenzen. Wie die Empfindungen Von
Farben im Auge hervorgerufen werden, haben R itter und P urkinje
gezeigt. Es sind heutzutage die Zeiten nicht mehr, in welchen
man diese Lichterscheinung im A«ge als eine Entwickelung
von Lichtmaterie ansah. In diesem Fall .müsste-das hierbei entwickelte
Licht die Fähigkeit zu. beleuchten haben, und man
müsste im Dunkeln dabei sehen können; diess ist aber nicht der
Fall. Die Lichtempfindung ist hier vielmehr die gewöhnliche
Reaction des Sehnervens, welcher gegen alle Reize, mechanische
sowohl als elektrische, Licht als einen Zustand seiner selbst empfindet,
der bloss subjectiv und die Qualität der Empfindung ist,
gleichwie Wollust und Schmerz Qualitäten oder Zustände anderer
Nerven, nämlich der Gefühlsnerven sind, während der Sehnerve
bloss der Empfindung von Licht und Farben, nach Ma-
gendie aber nicht der Empfindung des Schmerzes fähig ist. Diese
Ansicht von der Natur jener Lichterscheinungen, welche nach
den einflussreichen Versuchen von P urkinje über das subjective
Sehen, und nach unseren eigenen zahlreichen Erfahrungen in
diesem Felde unausweichlich ist, sehen wir auch von Physikern
des ersten Ranges vorgetragen. So erklärt nämlich P faff die
erwähnte Erscheinung, indem: „überhaupt Reize von der verschiedensten
Art, namentlich mancherlei mechanische, die. auf das
Auge einwirken, in dem Sehnerven die 'specifische Empfindung,
durch welche erreagirt, Lichterscheinungen unter mancherlei Gestalten,
als Blitze u. s. w., hervorbringen.“ Gleichwie die Elektricität
im Auge einen Zustand des Sehnerven als Lichtempfindung bewirkt,
so bewirkt sie in dem Gehörnerven einen Zustand als Tonempfindung.
V olta empfand, als sich seine Ohren in der Kette
einer Säule von 40 Plattenpaaren befanden, im Augenblick der
Schliessung eine Erschütterung im Kopfe, und einige Augenblicke
nachher ein Zischen und stossweises Geräusch, wie wenn
eine zähe Materie kochte, welches die ganze Zeit der Schliessung
der Kette fortdauerte. Philos. transact. 1800. p. 427. R itter
empfand bei der Schliessung der Kette, wenn beide Ohren
sich darin befanden, einen Ton wie G der eingestrichenen Octave
oder g"; befand sich nur ein Ohr in der Kette, so war vom
positiven Pol aus der Ton tiefer als gT, am negativen aber hö-
6 3 1
her. Ueber die Wirkungen der Elektricität auf die Absonderungen
siehe oben p. 466.
]I. U e b e r d i e V e r ä n d e r u n g d e r R e i z b a r k e i t d u r c h die Re i z e
Bisher haben wir bloss die Erscheinungen der Kräfte untersucht,
welche durch die Anwendung der B.eize entstehen. Jetzt
werden wir die Veränderungen der Kräfte selbst betrachten.
Alle reizenden Einflüsse, welche in den Nerven durch Veränderung
der Materie Erscheinungen ihrer Kräfte hervorrufen, können
auch die Reizbarkeit selbst verändern. Bei jeder Reaction
findet ein Aufwand der vorhandenen Kräfte statt, insofern sie
durch Veränderung der Materie bewirkt wird, je länger die Reizung
dauert, um so grösser ist diese Veränderung. In dem gesunden
Leben ist die Erregung nie so gross, dass durch gewaltsame
Veränderung der Materie die Fähigkeit zu Lebensäusserungen auf
eine empfindliche Art verletzt wird. Die beständige Wiedererzeugung,
die Ausgleichung der materiellen Veränderungen durch
die iwährend der.Ernährung fortgesetzte Wiedererzeugung, gleicht
die täglichen Veränderungen aus. Wenn aber die Reizung stärker
wird, so reicht die Wiedererzeugung nicht so-bald hin, um
diesen Verlust zu ersetzen, und die Reizung kann so stark seyn,
dass sie die Summe der vorhandenen Kräfte erschöpft. Diese
Verhältnisse, welche wir in der Ausübung der Muskelbewegung, des
Geschlechtstriebs, der Geistesfunctionen täglich kennen lernen, finden
auch bei der unmittelbaren Anwendung der Reize auf die
Nerven, statt. Wenn man einen Nerven, lange galvanisirt, so werden
die Reactionen immer . schwächer und zuletzt Null, und es
bedarf einiger.Zeit, ehe wieder Reaction erfolgt, wenn sich nämlich
die Nervenkraft (durch den Contact mit dem Blut) wieder
erholt hat. Es ist eben so mit den Empfindungen. Je länger
man ein farbiges Bild ansieht, um so schmutziger wird es und
es verschwindet zuletzt in Grau, je mehr die vom Licht gereizte
Stelle an Reactionskräft verliert; diese Stelle sieht zuletzt
gar nicht mehr. In allen diesen Fällen wird die Reizbarkeit
durch die Reizung erschöpft, und nicht durch die eigenthümli-
che Wirkung der Einflüsse. Die Reizbarkeit kann aber auch,
was Brown nicht glaubte, was aber von der Theorie des Con-
trastimulo besonders anerkannt worden ist, durch Einflüsse unmittelbar
ohne Reizung sogleich erschöpft jwerden, wenn eine
fremdartige Potenz sich unmittelbar auf Kosten der organischen
Combinationen geltend macht und den Nerven mit der Nervenkraft
vernichtet. So wirkt die Elektricität im höchsten Grade
des Effects im.Blitz, eben so der Druck, die Zerquetschung des
Nerven und seiner Primitivfasern, ferner die Behandlung der
Nerven mit chemischen Agentien, welche die organische Corabi-
nation des Nerven aufheben, und zersetzen, wie die mineralischen
Säuren, die Metallsalze, Alkohol im concentrirten Zustande.
Wirkt diese fremdartige Gewalt auf alle Nerven zugleich,
wie die Elektricität in dem Blitze, oder eine sehr starke Batterie,
oder wird ein Nerve in seiner ganzen Länge ausgedehnt, so wird
M i i l l e r 's Physiologie, l* 4 1