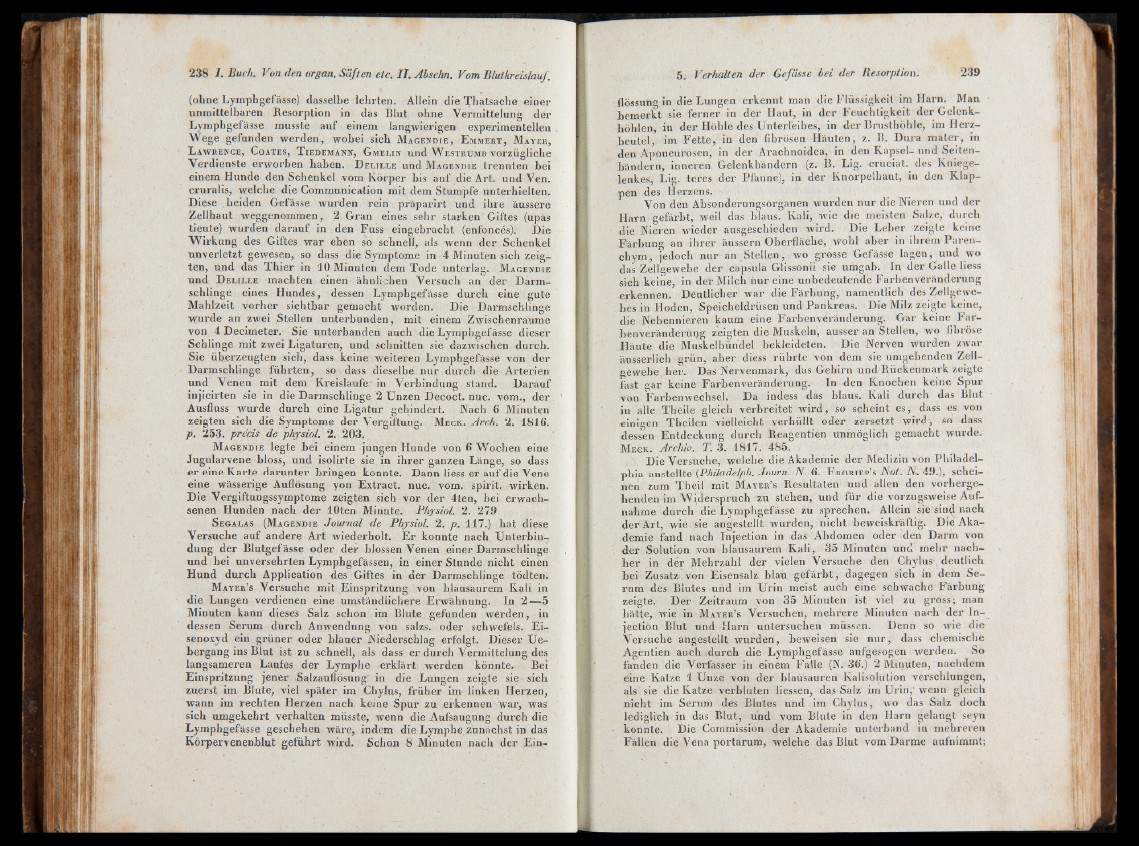
(ohne Lymphgefässe) dasselbe lehrten. Allein die Thatsache einer
unmittelbaren Resorption in das Blut ohne Vermittelung der
Lymphgefässe musste auf einem langwierigen experimentellen
Wege gefunden werden, wobei sich Magendie, E mmebt, Mayer,
L awrence, Coates, T iedemann, G melin und W estrumb vorzügliche
Verdienste erworben haben. D elille und Magendie trennten bei
einem Hunde den Schenkel vom Körper bis auf die Art. und Ven.
cruralis, welche die Communication mit dem Stumpfe unterhielten.
Diese beiden Gefässe wurden rein präparirt und ihre äussere
Zellhaut weggenommen, 2 Gran eines sehr starken Giftes (upas
tieute) wurden darauf in den Fuss eingebracht (enfoncés)," Die
Wirkung des Giftes war eben so schnell, als wenn der Schenkel
unverletzt gewesen, sp dass die Symptome in 4 Minuten sich zeigten,
und das Thier in 10 Minuten dem Tode unterlag. Magendie
und D elille machten einen ähnlichen Versuch an der Darmschlinge
eines Hundes., dessen Lymphgefässe durch eine gute
Mahlzeit vorher sichtbar gemacht worden. Die Darmschlinge
lourde an zwei Stellen unterbunden, mit einem Zwischenräume
von 4 Decimeter. Sie unterbanden auch die Lymphgefässe dieser
Schlinge mit zwei Ligaturen, und schnitten sie dazwischen durch.
Sie überzeugten sich, dass keine weiteren Lymphgefässe von der
Darmschlinge führten, so dass dieselbe nur durch die Arterien
und Venen mit dem Kreisläufe' in Verbindung stand. Darauf
injicirten sie in die Darmschlinge 2 Unzen Decoct. nuc. vom., der
Ausfluss wurde durch eine Ligatur gehindert. Nach 6 Minuten
zeigten sich die Symptome der Vergiftung. Meck. Arch. 2. 1816.
p. 253. précis de physiol. 2. 203.
Magendie legte bei einem jungen Hunde von 6 Wochen eine
Jugülarvene bloss, und isolirte sie in ihrer ganzen Länge, so dass
er eine Karte darunter bringen konnte. Dann liess er auf die Vene
eine wässerige Auflösung von Extract, nuc. vom. spirit, wirken.
Die Vergiftungssymptome zeigten sich vor der 4ten, bei erwachsenen
Hunden nach der lOten Minute. Physiol. 2. 279
S egalas (Magendie Journal de Physiol. 2. p. 117.) hat diese
Versuche auf andere Art wiederholt. Er konnte nach. Unterbindung
der Blutgefässe oder der blossen Venen einer Darmschlinge
und bei unversehrten Lymphgefässen, in einer Stunde nicht einen
Hund durch Application des Giftes in der Darmschlinge tödten.
Mayer’s Versuche mit Einspritzung von blausaurem Kali in
die Lungen verdienen eine umständlichere Erwähnung. In 2—5
Minuten kann dieses Salz schon im Blute gefunden wérden, in
d e ssen Serum durch Anwendung von salzs. oder Schwefels. Eisenoxyd
ein grüner oder blauer Niederschlag erfolgt. Dieser Ue-
bergang ins Blut ist zu schnell, als dass er durch Vermittelung des
langsameren Laufes der Lymphe erklärt werden könnte. Bei
Einspritzung jener Salzauflösung’ in die Lungen zeigte sie sich
zuerst im Blute, viel später im Cliylus, früher im linken Herzen,
wann im rechten Herzen nach keine Spur zu erkennen war, wäS
sich umgekehrt verhalten müsste, wenn die Aufsaugung durch die
Lymphgefässe geschehen wäre, indem die Lymphe zunächst in das
Körpervenenblut geführt wird. Schon 8 Minuten nach der Einflössuhg
in die Lungen erkennt man die Flüssigkeit im Harn. Man
bemerkt sie ferner in der Haut, in der Feuchtigkeit der Gelenkhöhlen,
in der Höhle des Unterleibes, in der Brusthöhle, im Herzbeutel,
im Fette, in den fibrösen Häuten, z. B. Dura mater, in
den Aponeurosen, in der Arachnoidea, in den Kapsel-und Seitenbändern,
inneren Gelenkbändern (z. B. Lig. cruciat. des Kniegelenkes,
Lig. teres der Pfanne), in der Knorpelhaut, in den Klappen
des Herzens.
Von den Absonderungsorganen wurden nur die Nieren und der
Harn gefärbt, weil das blaus. Kali, wie die meisten Salze, durch
die Nieren wieder ausgeschieden wird. Die Leber zeigte keine
Färbung an ihrer äussern Oberfläche* wohl aber in ihrem Parenchym,
jedoch nur an Stellen, wo grosse Gefässe lagen, und wo
das Zellgewebe der capsula Glissonii sie umgab; In der Galle liess
sich keine, in der Milch nur eine unbedeutende Farbenveränderung
erkennen. Deutlicher: war die Färbung, namentlich des Zellgewebes
in Hoden, Speicheldrüsen und Pankreas. Die Milz zeigte keine,
die Nebennieren kaum eine Farbenveränderung. Gar keine Far-
benveränderuijg zeigten die Muskeln, ausser an Stellen, wo fibröse
Häute die Muskelbündel bekleideten. Die Nerven wurden zwar
äusserlich grün, aber diess rührte von dem sie umgebenden Zellgewebe,
her. Das Nervenmark, das Gehirn und Rückenmark zeigte
fast gar keine Farbenveränderung. In den Knochen keine Spur
von Farbenwechsel. Da indess das blaus. Kali durch das Blut
in älle Theile gleich verbreitet wird,, so scheint es, dass es. von
einigen Theilen vielleicht verhüllt oder zersetzt wird, so dass
dessen Entdeckung durch Reagentien Unmöglich gemacht wurde.
Meck. Archiv. T. 3. 1817. 485.
Die Versuche, welche die Akademie der Medizin von Philadelphia
anstellte (Philadelph. Journ. IV. 6. F roriep’s Not. IV, 49.), scheinen
zum Theil mit M ayer’s Resultaten und allen den vorhergehenden
im Widerspruch zu stehen, und für die vorzugsweise Aufnahme
durch die Lymphgefässe zu sprechen. Allein sie sind nach
der Art, wie sie angestellt wurden, nicht beweiskräftig. Die Akademie
fand nach Injection in das Abdomen oder den Darm von
der Solution von blatisaurem Kali, 35 Minuten und mehr nachher
in dér Mehrzahl der vielen Versuche den Chylus’, deutlich
bei Zusatz von Eisensalz blau gefärbt, dagegen sich in dem Serum
des Blutes und im Urin meist auch eine schwache Färbung
zeigte. Der Zeitraum yon 35 Minuten ist viel zu gross; man
hätte, wie in Mayer’s Versuchen, mehrere Minuten nach der Injection
Blut und Harn untersuchen müssen. Denn so wie die
Versuche angestellt, wurden, beweisen sie nur," dass chemische
Agentien auch durch die Lymphgefässe aufgesogen werden. So
fanden die Verfasser in einem Falle (N. 36.) 2 Minuten, nachdem
eine Katze 1 Unze von der blausauren Kalisolution verschlungen,
als sie die Katze verbluten Hessen, das Salz im Urin,' wenn gleich
nicht im Serum des Blutes und im Chylus, wo das Salz doch
lediglich in das Blut, und vom Blute in den Harn gelangt seyn
konnte. Die Commission der Akademie unterband in mehreren
Fällen die Vena portarum, welche das Blut vom Darme aufnimmt;