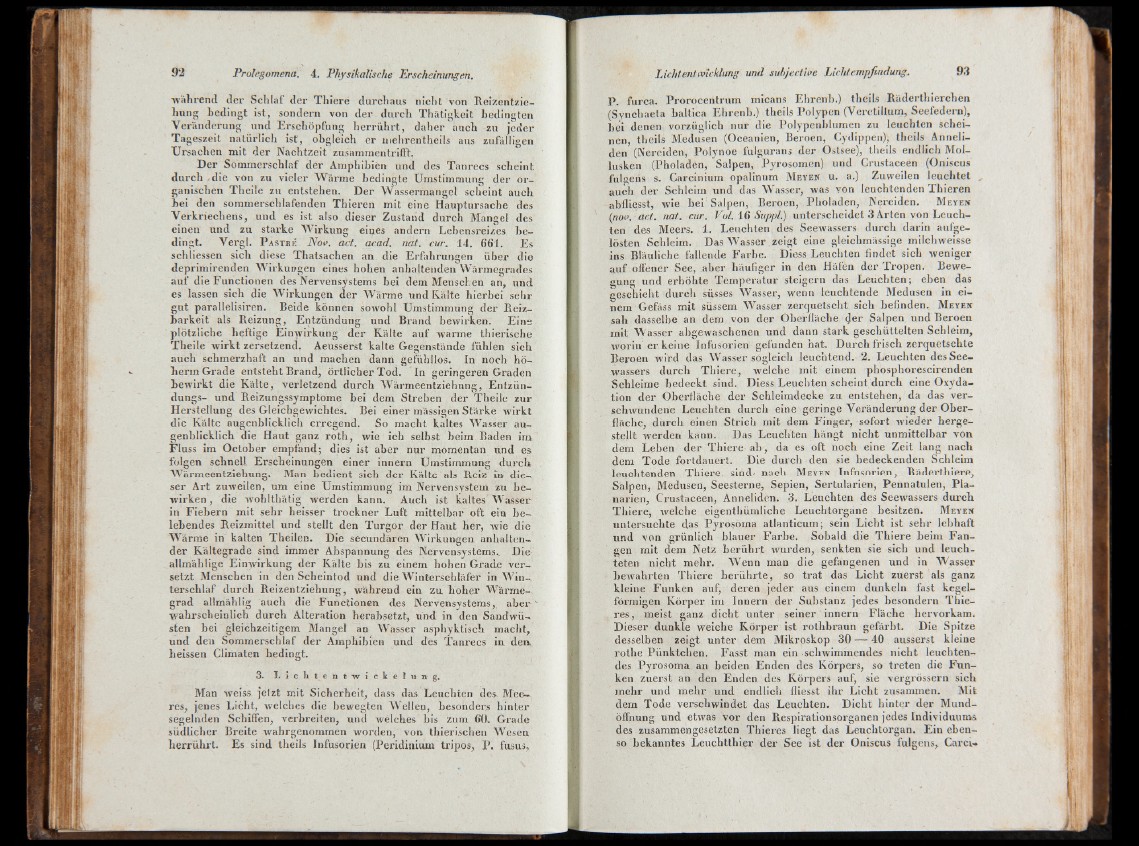
■während der Schlaf der Thiere durchaus nicht von Reizentziehung
bedingt ist, sondern von der durch Thätigkeit bedingten
Veränderung u n d Erschöpfung herrührt, daher auch zu jeder
Tageszeit natürlich ist', obgleich er niehrentheils aus zufälligen
Ursachen mit der Nachtzeit znsammentrifft,
Der Sommerschlaf der Amphibien und des Tanrecs scheint
durch die von zu vieler Wärme bedingte Umstimmung der organischen
Theile zu entstehen. Der Wassermangel scheint auch
bei den sommerschlafenden Thieren mit eine Hauptursache des
Verkriechens, und es ist also dieser Zustand durch Mangel des
einen und zu starke Wirkung eines andern Lebensreizes bedingt.
Vergl. P astbe Noo. act. acad. nat. cur. 14. 661. Es
schliessen sich diese Thatsachen an die Erfahrungen über die
deprimirenden Wirkungen eines hohen anhaltenden Wärmegrades
auf die Functionen des Nervensystems bei dem Menschen an, und
es lassen sich die Wirkungen der Wärme und Kälte hierbei sehr
gut parallelisiren. Beide können sowohl Umstimmung der Reizbarkeit
als Reizung, Entzündung und Brand bewirken. Eins
plötzliche heftige Einwirkung der Kälte auf warme thierische
Theile wirkt zersetzend. Aeusserst kalte Gegenstände fühlen sich
auch schmerzhaft an und machen dann gefühllos. In noch hö-
herm Grade entsteht Brand, örtlicher Tod. In geringeren Graden
bewirkt die Kälte, verletzend durch Wärmeentziehnng, Entzün-
dungs- und Reizungssymptome bei dem Streben der Theile zur
Herstellung des Gleichgewichtes. Bei einer massigen Stärke wirkt
die Kälte augenblicklich erregend. So macht kaltes Wasser augenblicklich
die Haut ganz roth, wie ich selbst beim Baden im
Fluss im October empfand; dies ist aber nur momentan und es
folgen schnell Erscheinungen einer innern Umstimmung durch
Wärmeentziehung. Man bedient sich der Kälte als Reiz in dieser
Art zuweilen, um eine Umstimmung im Nervensystem zu bewirken
, die wohlthätig werden kann. Auch ist kaltes Wasser
in Fiebern mit sehr heisser trockner Luft mittelbar oft ein belebendes
Reizmittel und stellt den Turgor der Haut her, wie die
Wärme in kalten Theilen. Die secundären Wirkungen anhaltender
Kältegrade sind immer Abspannung des Nervensystems.. Die
allmählige Einwirkung der Kälte bis zu einem hohen Grade versetzt
Menschen in den Scheintod und die Winterschläfer in Winterschlaf
durch Reizentziehung, während ein zu hoher Wärmegrad
allmählig auch die Functionen des Nervensystems, aber
wahrscheinlich durch Alteration herabsetzt, lind in den Sandwüsten
bei gleichzeitigem Mangel an Wasser asphyktisch macht,
und den Sommerschlaf der Amphibien und des Tanrecs in den,
heissen Climaten bedingt.
3. L i c h t e n t w i c k e t u n g .
Man weiss jetzt mit Sicherheit, dass das. Leuchten des. Meeres,
jenes l.icht, welches die bewegten Wellen, besonders hinter
segelnden Schiffen, verbreiten, und welches bis zum 60. Grade
südlicher Breite wahrgenommen worden, von thierischen Wesen
herrührt. Es sind theils Infusorien (Peridinium tripos, P. füsus,
P. furca. Prorocentrum micans Ehrenb.) theils Räderthierchen
(Syncliaeta baltica Ehrenb.) theils Polypen (Veretiilum, Seefedern),
bei denen vorzüglich nur die Polypenblumen zu leuchten scheinen,
theils Medusen (Océanien, Beroen, Cydippen), theils Anneliden
(Nereiden, Polynoe fulgurans der Ostsee), theils endlich Mollusken
(Pholaden, Salpen, Pyrosomen) und Crustaceen (Oniscus
ful°eris s. Carcinium opalinum Meyen u. a.) Zuweilen leuchtet .
auch der Schleim und das Wasser, was von leuchtenden Thieren
abfliesst, wie bei Salpen, Beroen, Pholaden, Nereiden. M eyen
(nov. act. nat. cur. Vol. 16 Suppl.) unterscheidet 3 Arten von Leuchten
des Meprs. 1. Leuchten des Seewassers durch darin aufgelösten
Schleim. Das Wasser zeigt eine gleichmässige milchweisse
ins Bläuliche fallende Farbe. Diess Leuchten findet sich weniger
auf offener See, aber häufiger in den Häfen der Tropen. Bewegung
und erhöhte Temperatur steigern das Leuchten; eben das
geschieht durch süsses Wasser, wenn leuchtende Medusen in einem
Gefäss mit süssem Wasser zerquetscht sich befinden. M eyen
sah dasselbe an dem von der Oberfläche 4er Salpen und Beroen
mit Wasser abgewaschenen und dann stark geschüttelten Schleim,
worin er keine Infusöi’ien gefunden hat. Durch frisch zerquetschte
Beroen wird das Wasser sogleich leuchtend. 2. Leuchten des Seewassers
durch Thiere, welche mit einem phosphorescirenden
Schleime bedeckt sind. Diess Leuchten scheint durch eine Oxydation
der Oberfläche der Schleimdecke zu entstehen, da das verschwundene
Leuchten durch eine geringe Veränderung der Oberfläche,
durch einen Strich mit dem Finger, sofort wieder hergestellt
werden kann. Das Leuchten bängt nicht unmittelbar von
dem Leben der Thiere ab, da es oft noch eine Zeit lang nach
dem Tode fortdauert. Die durch den sie bedeckenden Schleim
leuchtenden Thiere sind' nach M eyen Infusorien, Räderthiere,
Salpen, Medusen, Seesterne, Sepien, Sertularien, Pennatulen, Planarien,
Crustaceen, Anneliden. 3. Leuchten des Seewassers durch
Thiere, welche eigenthümliche Leuchtorgäne besitzen. Meyen
untersuchte das Pyrosorna atlanticum; sein Licht ist sehr lebhaft
und von grünlich blauer Farbe. Sobald die Thiere beim Fangen
mit dem Netz berührt wurden, senkten sie sich und leuchteten
nicht mehr. Wenn man die gefangenen und in Wasser
bewahrten Thiere berührte, so trat das Licht zuerst als ganz
kleine Funken auf, deren jeder aus einem dunkeln fast kegelförmigen
Körper im Innern der Substanz jedes besondern Thie-
res, meist ganz dicht unter seiner innern Fläche hervorkam.
Dieser dunkle weiche Körper ist rothbraun gefärbt. Die Spitze
desselben zeigt unter dem Mikroskop 30 — 40 ausserst kleine
rotlie Pünktchen. Fasst man ein schwimmendes nicht leuchtendes
Pyrosorna an beiden Enden des Körpers, so treten die Funken
zuerst an den Enden des Körpers auf, sie vergrössern sich
mehr und mehr und endlich fliesst ihr Licht zusammen. Mit
dem Tode verschwindet das Leuchten. Dicht hinter der Mundöffnung
und etwas Vor den Respirationsorganen jedes Individuums
des zusammengesetzten Thieres liegt das Leuchtorgan. Ein ebenso
bekanntes Leuchtthier der See ist der Oniscus fulgens, Carci