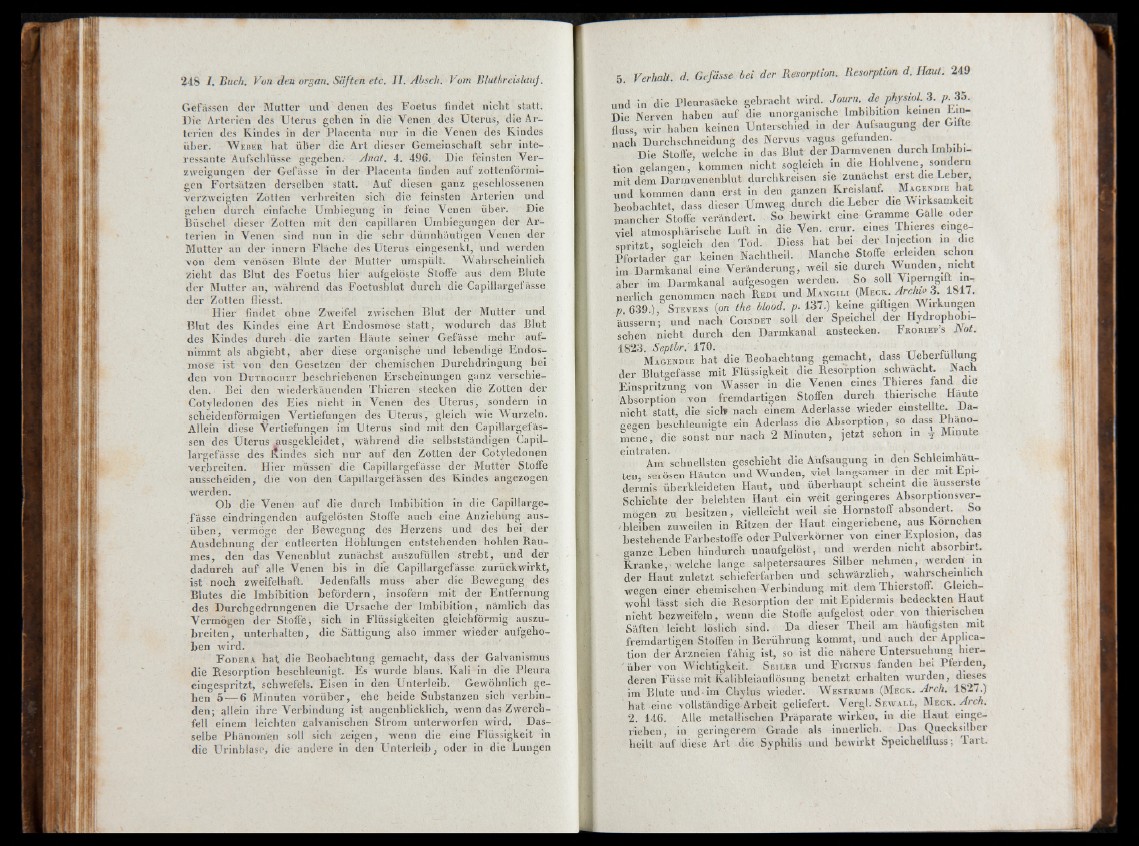
Gefässen der Mutter und denen des Foetus findet nicht statt.
Die Arterien des Uterus gehen in die Yenen des Uterus, die Arterien
des Kindes in der Placenta nur in die Venen des Kindes
über. W e b e r hat über die Art dieser Gemeinschaft sehr interessante
Aufschlüsse gegeben. Anat. 4. 496. Die feinsten Verzweigungen
der Gefässe in der Placenta finden auf zottenförmigen
Fortsätzen derselben statt. Auf diesen ganz geschlossenen
'verzweigten Zotten verbreiten sich die feinsten Arterien und
geben durch einfache Umbiegung in feine Venen über. Die
Büschel dieser Zotten mit den capillaren Umbiegungen der Arterien
in Venen sind nun in die sehr dünnhäutigen Venen der
Mutter an der innern Flache des Uterus eingesenkt, und werden
von dem venösen Blute der Mutter umspült. Wahrscheinlich
zieht das Blut des Foetus hier aufgelöste Stoffe aus dem Blute
der Mutter an, während das Foetusblut durch die Capillargefässe
der Zotten fliesst.
Hier findet ohne Zweifel zwischen Blut der Mutter und
Blut des Kindes eine Art Endosmose statt, wodurch das Blut
des Kindes durch • die zarten Häute seiner Gefässe mehr aufnimmt
als abgiebt, aber diese organische und lebendige Endosmose'
ist von den Gesetzen der chemischen Durchdringung bei
den von D xjtrochet beschriebenen Erscheinungen ganz verschieden.
Bei den wiederkäuenden Thieren stecken die Zotten der
Cotyledonen des Eies nicht in Venen des Uterus, sondern in
scheidenförmigen Vertiefungen des Uterus, gleich wie Wurzeln.
Allein diese Vertiefungen im Uterus sind mit den Capillargefäs-
sen des Uterus nusgekleidet, während die selbstständigen Capillargefässe
des Kindes sich nur auf den Zotten der Cotyledonen
verbreiten. Hier müssen' die Capillargefässe der Mutter Stoffe
ausscheiden, die von den Capillargefässen des Kindes angezogen
werden.
Ob die Venen auf die durch Imbibition in die Capillargefässe
eindringenden aufgelösten Stoffe auch eine. Anziehung ausüben,
vermöge der Bewegung des Herzens und des bei der
Ausdehnung der entleerten Höhlungen entstehenden hohlen Raumes,
den das Venenblut zunächst auszufüllen strebt, und der
dadurch auf alle Venen bis in die Capillargefässe zurückwirkt,
ist noch zweifelhaft. Jedenfalls muss aber die Bewegung des
Blutes die Imbibition befördern, insofern mit der Entfernung
des Durchgedrungenen die Ursache der Imbibition, nämlich das
Vermögen der Stoffe, sich in Flüssigkeiten gleichförmig auszubreiten,
unterhalten, die Sättigung also immer wieder aufgehoben
wird.
F obera hat die Beobachtung gemacht, dass der Galvanismus
die Resorption beschleunigt. Es wurde blaus. Kali in die Pleura
eingespritzt, Schwefels. Eisen in den Unterleib. Gewöhnlich gehen
5 — 6 Minuten vorüber, ehe beide Substanzen sich verbinden;
allein ihre Verbindung ist augenblicklich, wenn das Zwerchfell
einem leichten galvanischen Strom unterworfen wird. Das-’
selbe Phänomen soll sich zeigen, wenn die eine Flüssigkeit in
die Urinblase, die andere in den Unterleib, oder in die Lungen
und in die Pleurasäcke gebracht wird. Journ. de physiol. 3. p. 35.
Die Nerven haben auf die unorganische Imbibition keinen Einfluss,
wir haben keinen Unterschied in der Aufsaugung der Gitte
nach Durchschneidung des Nervus vagus gefunden. _
Die Stoffe, welche in das Blut der Darmvenen durch Imbibition
gelangen, kommen nicht sogleich in die Hohlvene, sondern
mit dem Darmvenenblut durchkreisen sie zunächst erst die Leber,
und kommen'dann erst in den ganzen Kreislauf. M agendie hat
beobachtet, dass dieser Umweg durch die Leber die Wirksamkeit
mancher Stoffe verändert. So bewirkt eine Gramme Galle oder
viel atmosphärische Luft in die Ven. crur. eines Thieres eingespritzt,
sogleich den Tod. Diess hat bei der Injection in die
Pfortader gar keinen Nachtheil. Manche Stoffe erleiden schon
Im Darmkanal eine Veränderung, weil sie durch Wunden, nicht
aber im Darmkanal aufgesogen werden. So soll Viperngift innerlich
genommen nach R edi und Mangili (Meck. Archiv 3. 1817.
p 639.), Stevens (on the blood. p. 137.) keine giftigen Wirkungen
äussern; und nach Coindet soll der Speichel der Hydrophobi-
schen nicht durch den Darmkanal anstecken. F roriep s JSot.
1823. Septbr. 170. Tt u e- n „
Magendie hat die Beobachtung gemacht, dass Uebertullung
der Blutgefässe mit Flüssigkeit die Resorption schwächt. Nach
Einspritzung von Wasser in die Venen eines Thieres fand die
Absorption von fremdartigen Stoffen durch thierische Haute
nicht statt, die siel» nach einem Aderlässe wieder einstellte. Dagegen
beschleunigte ein Aderlass die Absorption so dass Phänomene,
die sonst nur nach 2 Minuten, jetzt schon in 2 Minu e
eintraAtemn . schnellsten geschieht die Aufsaugung in d, en' cS cuhil e•i muh-äuten,
serösen Häuten und Wunden, viel langsamer in der mit Epidermis
überkleideten Haut, und überhaupt scheint die äusserste
Schichte der belebten Haut ein weit geringeres Absorptionsvermögen
zu besitzen, vielleicht weil sie Hornstoff absondert. So
'bleiben zuweilen in Ritzen der Haut eingeriebene, aus Körnchen
bestehende Farbestoffö oder Pulverkörner von einer Explosion, das
ganze Leben hindurch unaufgelöst, und werden nicht absorhirt.
Kranke,'welche lange salpetersaures Silber nehmen, werden' m
der Haut zuletzt schiefer färben und schwärzlich, wahrscheinlich
wegen einer chemischen -Verbindung mit dem Thierstoff. Gleich-
wohl lässt sich die Resorption der mit Epidermis bedeckten Haut
nicht bezweifeln, wenn die Stoffe aufgelöst oder von thierischen
Säften leicht löslich sind. Da dieser Theil am häufigsten mit
fremdartigen Stoffen in Berührung kommt, und auch der Application
der Arzneien fähig ist, so ist die nähere Untersuchung hier-
über von Wichtigkeit. S eiler und F icinus fanden bei Pferden,
deren Füsse mit Kalibleiauflösung benetzt erhalten wurden, dieses
im Blute und-im Chylus wieder. W estrumb (Meck. Arch. 182/.)
hat eine vollständige Arbeit geliefert. Vergl. S ewall, Meck. Arch.
2. 146. Alle metallischen Präparate wirken, in die Haut eingerieben,
in geringerem Grade als -innerlich. Das Quecksilber
h e ilt auf diese Art die Svnhilis und bewirkt SneichelfluSS: