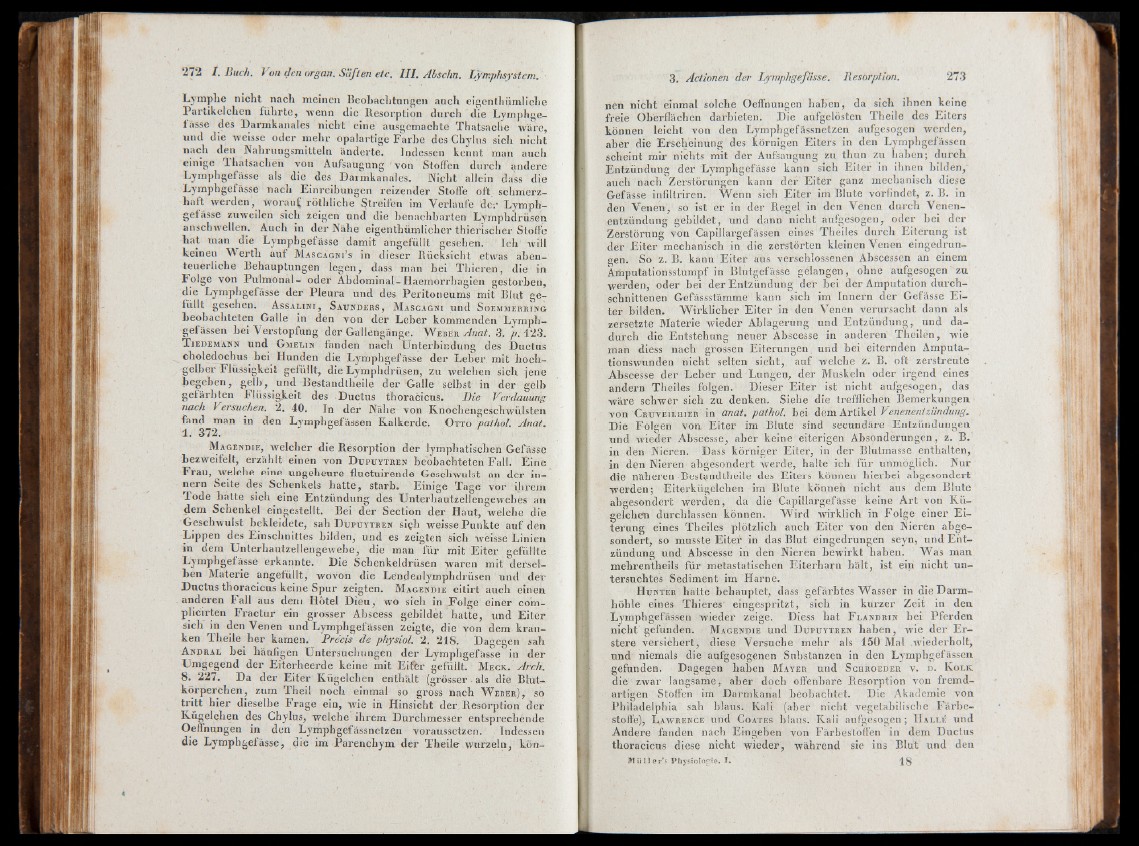
Lymplie nicht nach meinen Beobachtungen anch eigenthiimliche
Partikelchen führte, wenn die Resorption durch die Lymphgefässe
des Darmkanales nicht eine ausgemachte Thatsaclie wäre,
und die weisse oder mehr opalartige Farbe des Chylus sich nicht
nach den Nahrungsmitteln änderte. Indessen kennt man auch
einige Thatsachen von Aufsaugung'von Stoffen durch andere
Lymphgefässe als die des Darmkanales. Nicht allein dass die
Lymphgefässe nach Einreibungen reizender Stoffe oft. schmerzhaft
werden, worauf röthliche Streifen im Verlaufe der Lymphgefässe
zuweilen sich zeigen und die benachbarten Lyrnphdrüsen
anschwellen. Auch in der Nähe eigenthümlicher thierischer Stoffe
hat man die Lymphgefässe damit angefüllt gesehen. Ich will
keinen Werth auf Mascagni’s in dieser Rücksicht etwas abenteuerliche
Behauptungen legen, dass man bei Thieren, die in
Folge von Pulmonal- oder Abdominal-Haemörrhagien gestorben,
die Lymphgefässe der Pleura und des Peritoneums mit Blut gefüllt
gesehen. Assal ini, S aunders, Mascagni und S oemmerring
beobachteten Galle in den von der Leber kommenden Lymph-
gef ässen bei Verstopfung der Gallengänge. W eber Anat. 3> p . 123.
T iedemann und G melin fanden nach Unterbindung des Ductus
choledochus bei Hunden die Lymphgefässe der Leber mit hochgelber
Flüssigkeit gefüllt, die Lyrnphdrüsen, zu welchen sich jene
begeben, gelb, und Bestandtheile der Galle selbst in der gelb
gefärbten Flüssigkeit des Ductus thoracicus. Die Verdauung
nach Versuchen. 2 . 40. In der Nähe von Knochengeschwülsten
fand man in den Lymphgefässen Kalkerde. O tto pathol. Anat.
1. 372.
Magendie, welcher die Résorption der lymphatischen Gefässe
bezweifelt, erzählt einen von D upuytren beobachteten Fall. Eine
Frau, welche eine ungeheure flnctuirende Geschwulst an der inné
™ Seite des Schenkels hatte, starb. Einige Tage vor ihrem
Tode hatte sich eine Entzündung des Unterhautzellengewebes an
dem Schenkel eingestellt. Bei der Section der Haut, welche die
Geschwulst bekleidete, sah D upuytren siçh weisse Punkte auf den
Lippen des Einschnittes bilden, und es zeigten sich weisse Linien
in dem Unterhautzellengewebe, die man für mit Eiter gefüllte
Lymphgefässe erkannte. Die Scbenkeldrüsen waren mit derselben
Materie angefüllt, wovon die Lendenlymphdrüsen und der
Ductus thoracicus keine Spur zeigten. M agendie citirt auch einen
anderen Fall aus dem Hotel Dieu, wo sich in Folge einer com-
plicirten Fractur ein grosser Abscess gebildet hatte, und Eiter
sich' in den Venen und Lymphgefässen zeigte, die von dem kranken
Theile her kamen. 'Precis de physiol. 2. 218. Dagegen sah
Andral bei häufigen Untersuchungen der Lymphgefässe in der
Umgegend der Eiterheerde keine mit Eifér gefüllt. M eck. Arch.
8 . 227. Da der Eiter Kügelchen enthält (grösser . als die Blutkörperchen,
zum Theil noch einmal so gross nach W eber) , so
tritt hier dieselbe Frage ein, wie in Hinsicht der, Resorption der
Kügelchen des Chylus, welche ihrem Durchmesser entsprechende
Oeffnungen in den Lymphgefässnetzen voraussetzen. Indessen
die Lymphgefässe, die im Parenchym der Theile wurzeln, können
nicht einmal solche Oeffnungen haben, da sich ihnen keine
freie Oberflächen darbieten. Die aufgelösten Theile des Eiters
können leicht von den Lymphgefässnetzen aufgesogen werden,
aber die Erscheinung des körnigen Eiters in den Lymphgefässen
scheint mir nichts mit der Aufsaugung zu thun zu haben; durch
Entzündung der Lymphgefässe kann sich Eiter in ihnen bilden,
auch nach Zerstörungen kann der Eiter ganz mechanisch diese
Gefässe infiltriren. Wenn sich Eiter im Blute vorfindet, z. B. in
den Venen, so ist er in der Regel in den Venen durch Venenentzündung
gebildet, und dann nicht aufgesogen, oder bei der
Zerstörung von Capillärgef ässen eines Theiles durch Eiterung ist
der Eiter mechanisch in die zerstörten kleinen Venen eingedrungen.
So z. B. kann Eiter aus verschlossenen Abscessen an einem
Arhputationsstumpf in Blutgefässe gelangen, ohne aufgesogen zu
werden, oder bei der Entzündung der bei der Amputation durchschnittenen
Gefässstämme kann sich im Innern der Gefässe Eiter
bilden. Wirklicher Eiter in den Venen verursacht dann als
zersetzte Materie wieder Ablagerung und Entzündung, und dadurch
die Entstehung neuer Abscesse in anderen Theilen, wie
man diess nach grossen Eiterungen und bei eiternden Amputationswunden
nicht selten sieht, auf welche z. B. oft zerstreute
Abscesse der Leber und Lungen, der Muskeln oder irgend eines
andern Theiles folgen. Dieser Eiter ist nicht aufgesogen, das
wäre schwer sich zu denken. Siehe die trefflichen Bemerkungen ■
von Cruveilhier in anat. pathol. bei dem Artikel Venenenizündung.
Die Folgen von Eiter im Blute sind secundäre Entzündungen
und wieder Abscesse, aber keine eiterigen Absonderungen , z. B.
in den Nieren. Dass körniger Eiter, in der Blutmasse enthalten,
in den Nieren abgesondert werde, halte ich für unmöglich. Nur
die näheren Bestandtheile des Eiters können hierbei abgesondert
werden; Eiterkügelchen im Blute können nicht ans dem Blute
abgesondert werden, da die Gapillargefässe keine Art von Kügelchen
durchlassen können. Wird wirklich in Folge- einer Eiterung
eines Theiles plötzlich auch Eiter von den Nieren abgesondert,
so musste Eiter in das Blut eingedrungen seyn, und Entzündung
und Abscesse in den Nieren bewirkt haben. Was man
mehrentheils für metastatischen Eiterharn hält, ist ein nicht untersuchtes
Sediment im Harne.
H unter hatte behauptet, dass gefärbtes Wasser in die Darmhöhle
eines Tbieres' eingespritzt, sich in kurzer Zeit in den
Lymphgefässen wieder zeige. Diess hat F landrin bei Pferden
nicht gefunden. M agendie und D upuytren haben, wie der Er-
stere versichert, diese Versuche mehr als 150 Mal wiederholt,
und niemals die aufgesogenen Substanzen in den Lymphgefässen
gefunden. Dagegen haben Mayer und S chroeder v. d. K olk
die zwar langsame, aber doch offenbare Resorption von fremdartigen
Stoffen im Darmkanal beobachtet. Die Akademie von
Philadelphia sah blaus. Kali (aber nicht vegetabilische Färbestoffe),
L awrence und Coates blaus. Kali aufgesogen; H alle und
Andere fanden nach Eingeben von Färbestoffen in dem Ductus
thoracicus diese nicht wieder, während sie ins Blut und den
Miille r’s Physiologie. I. 18