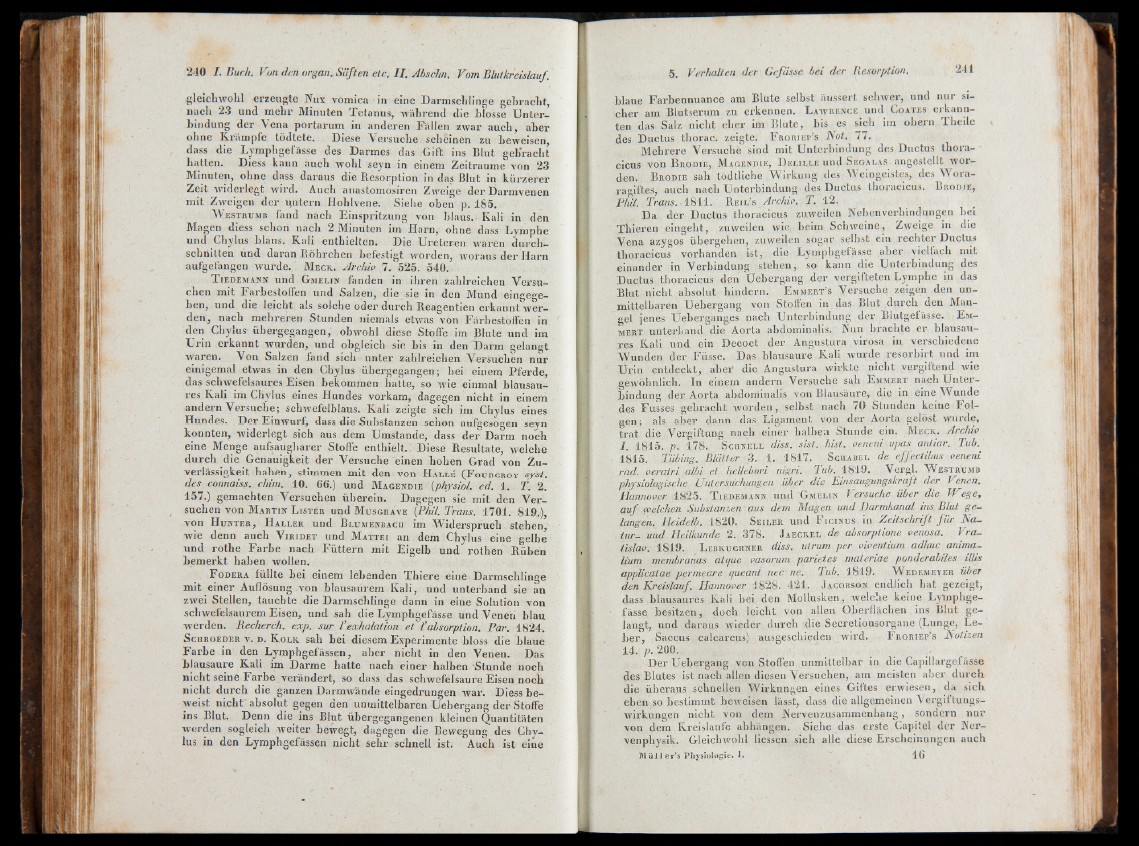
gleichwohl erzeugte Nux vomica in eine Darmschlinge gebracht,
nach 23 und mehr Minuten Tetanus, während die blosse Unterbindung
der Vena portarum in anderen Fällen zwar auch, aber
ohne Krämpfe tödtete. Diese Versuche scheinen zu beweisen,
dass die Lymphgefässe des Darmes das Gift ins Blut gebracht
hatten. Diess kann auch wohl 'seyn in einem Zeiträume von 23
Minuten, ohne dass daraus die Resorption in das Blut in kürzerer
Zeit widerlegt wird. Auch anastomosiren Zweige der Darmvenen
mit Zweigen der gutem Hohlvene. Siehe oben p. 185.
W estrumb fand nach Einspritzung von blaus.- Kali in den
Magen diess schon nach 2 Minuten im Harn, ohne dass Lymphe
und Chylus blaus. Kali enthielten. Die Ureteren waren durchschnitten
und daran Röhrchen befestigt wmrden, woraus der Harn
aufgefangen wurde., M eck, Archiv 7, 525. 540.
T iedemann und Gmelin fanden in ihren zahlreichen Versuchen
mit Farbestoffen und Salzen, die sie in den Mund eingege—
ben, und die leicht als solche oder durch Reagentien erkannt werden,
nach mehreren Stunden niemals etwas von Färbestoffen in
den Chylus-übergegangen, obwohl diese Stoffe im Blute und im
Urin erkannt wurden, und obgleich sie bis in denTfarm gelangt
waren. Von Salzen fand sich unter zahlreichen Versuchen nur
einigemal etwas in den Chylus übergegangen; bei einem Pferde,
das schwefelsaures Eisen bekommen batte, so wie einmal blausaures
Kali im Chylus eines Hundes vorkam, dagegen nicht in einem
andern Versuche; schwefelblaus. Kali zeigte sich im Chylus eines
Hundes. Der Einwurf, dass die Substanzen schon aufgesogen seyn
konnten, widerlegt sich aus dem Umstande, dass der Darm noch
eine Menge aufsaügharer Stoffe enthielt., Diese Resultate, welche
durch die Genauigkeit der Versuche einen hohen Grad von Zuverlässigkeit
haben, stimmen mit den von H alle ( F ouecrov syst,
des connais,s. clnm. 10. 66.) und Magendie (physiol. ed. 1. T. 2.
157.) gemachten Versuchen überein. Dagegen sie mit den Versuchen
von Martin L istér und Musgrave {Phil. Trans. 1701. 819,),
von H unter, H aller und Blumenbach im Widerspruch. stehen,
wie denn auch V iridet und Mattei an dem Cfiylus eine gelbe
und rothe Farbe nach Füttern mit Eigelb und rothen Rüben
bemerkt haben wollen.
F odera füllte bei einem lebenden Thiere eine Darmschlinge
mit einer Auflösung von blausaurem Kali, und unterband sie an
zwei Stellen, tauchte die Darmschlinge dann in eine Solution von
schwefelsaurem Eisen, und sah die Lymphgefässe und Venen blau
werden. Reckerch. exp. sur 1’exhalation et l ’absorption. Par. 1824.
S chroeder v. d. K olk sah bei diesem Experimente bloss die blaue
Farbe in den Lymphgefässen, aber nicht in den Venen. Das
blausaure Kali im Darme hatte nach einer halben Stunde noch
nicht seine Farbe verändert, so dass das schwefelsaure Eisen noch
nicht durch die ganzen Darmwände eingedrungen war. Diess beweist
nicht absolut gegen den unmittelbaren Uebergang der Stoffe
ins Blut. Denn die ins Blut übergegangenen kleinen Quantitäten
werden sogleich -weiter bewegt, dagegen die Bewegung des Chylus
in den Lymphgefässen nicht sehr schnell ist. Auch ist eine
blaue Farbennuance am Blute selbst äussert schwer, und nur sicher
am Blutserum zu erkennen. L awrence und Coates erkannten
das Salz nicht eher im Blute, bis es sich im obern Theile
des Ductus thorac. zeigte. F roriep’s Not. 77.
Mehrere Versuche' sind mit Unterbindung des Ductus thora-
cicus von B rodie, Magendie, D elille und S egalas angestellt worden.
Brodie sah tödtliche Wirkung des Weingeistes, des Wora-
ragiftes, auch n a ch TJnterbindung-des Ductus thoracicus. Brodie,
Phil. Trans. 1811. R eil’s Archiv. T. 12.
Da der Ductus thoracicus zuweilen Nebenverbindungen bei
Thieren eingeht, zuweilen wie, beim Schweine, Zweige in die
Vena azygos übergehen, zuweilen sogar selbst ein rechter Ductus
thoracicus vorhanden ist, die Lymphgefässe aber vielfach mit
einander in Verbindung stehen, so kann die Unterbindung des
Ductus thoracicus den Uebergang der vergifteten Lymphe in das
Blut nicht absolut hindern. E mmert’s Versuche zeigen den unmittelbaren
Uebergang von Stoffen in das Blut durch den Mangel
jenes üeberganges nach Unterbindung der Blutgefässe. E m-
mert unterband die Aorta abdominalis. Nun brachte er blausaures
Kali und ein Decoct der Angustura virosa in verschiedene
Wunden der Füsse. Das blaüsaure Kali wurde resorbirt und im
l)rin entdeckt, aber' die Angustura wirkte nicht vergiftend wie
gewöhnlich. In einein andern Versuche sah E mmert nach Unterbindung
der Aorta abdominalis von Blausäure, die in eine Wunde
des Fu'sses gebracht worden, selbst nach 70 Stunden keine Folgen;
als aber dann das Ligament von der Aorta gelöst wurde,
trat die Vergiftung nach einer halben Stunde ein. Meck. Archiv
I. 1815. p. 178. S chnell diss. sist. hist, veneni upas antiar. Tub.
1815. Tübing. Blätter 3. 1. 1817. S chabel de effectibus veneni
rad. veratri albi et hellebori nigri. Tul. 1819. Vergl. W estrümb
physiologische Untersuchungen über die Einsaugungskraft der Venen.
Hannover 1825. T iedemann und G melin Versuche über die Wege,
auf welchen Substanzen 'aus dem Magen und Harmkanal ins Blut gelangen.
Heidelb. 1820. S eiler und F icinus in Zeitschrift fü r Natur
und Heilkunde 2. 378. J aeckel de absorptione venosa. Vra-
tislav. 1819. L ebküchner diss. utrum per viventium adhuc anima-
lium membranas atque vasorum pariet.es materiae ponderabiles illis
applicatae permeare queant nec ne. Tub. 1819. W edemeyer über
den Kreislauf. Hannover 1828. 421. J acobson endlich hat gezeigt,
dass blausaures Kali bei den Mollusken, welche keine Lymphgefässe
besitzen, doch leicht von allen Oberflächen ins Blut gelangt,
und daraus wieder durch die Secretionsorgane (Lunge, Leber,
Saccus calcareus) ausgeschieden wird. F roriep’s Notizen
14. p. 200.
Der Uebergang von Stoffen unmittelbar in die Capillargefässe
des Blutes ist nach allen diesen Versuchen, am meisten aber durch
die überaus schnellen Wirkungen eines Giftes erwiesen, da sich
eben so bestimmt beweisen lässt, dass die allgemeinen Vergiftungswirkungen
nicht von dem Nervenzusammenhang, sondern nur
von dem Kreisläufe abhängen. Siehe das erste Capitel der Ner-
venphysik. Gleichwohl Hessen sich alle diese Erscheinungen auch
Müll er’s Physiologie. I. 16