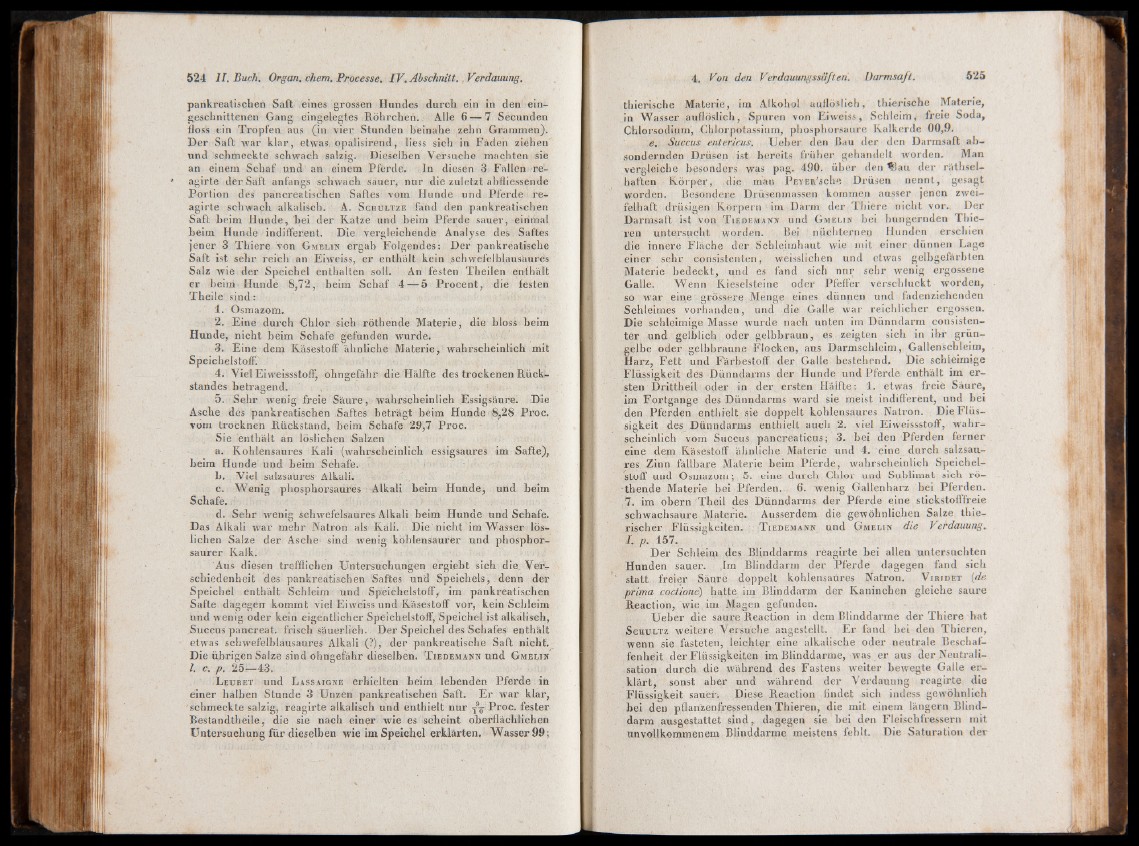
pankreatischen Saft eines grossen Hundes durch ein in den eingeschnittenen
Gang eingelegtes Röhrchen, i Alle 6 — 7 Secunden
floss ein Tropfen aus (in vier Stunden beinahe zehn Grammen).
Der Saft war klar, etwas, opalisirend, liess sich in Fäden ziehen
und schmeckte schwach salzig. Dieselben Versuche machten sie
an einem Schaf und an einem Pferde. In diesen 3; Fällen re-
agirte der Saft anfangs schwach sauer, nur die zuletzt abfliessende
Portion des pancreatischen Saftes vom Hunde und Pferde: re-
agirte schwach alkalisch. A. Schultze fand den pankreatischen
Saft heim Hunde, bei der Ratze und beim Pferde sauer, einmal
beim Hunde indifferent. Die vergleichende Analyse des Saftes
jener 3 Thiere von Gmelin ergab Folgendes: Der pankreatische
Saft ist sehr reich an Eiweiss, er enthält kein schwefelblausäurös
Salz wie der Speichel enthalten soll. An festen Theilen enthält
er beim Hunde 8,72, beim Schaf 4 — 5 Procent, die festen
Theile sind:
1. Osmazom.
2. Eine durch Chlor sich, röthende Materie, die bloss beim
Hunde, nicht beim Schafe gefunden wurde.
3. Eine dem Käsestoff ähnliche Materie, wahrscheinlich mit
Speichelstoff?
4. Viel Eiweissstoff, ohngefähr die Hälfte des trockenen Rückstandes'
betragend.
5. Sehr wenig freie Säure, wahrscheinlich Essigsäure. Die
Asche des pankreatischen Saftes beträgt beim Hunde 8,28 Proc.
vom trocknen Rückstand, beim Schafe 29,7 Proc.
Sie enthält an löslichen Salzen
a. Rohlensaures Kali (wahrscheinlich esSigsaures im Safte),
beim Hunde und beim Schafe. •
b. Viel salzsaüres Alkali.
c. Wenig phosphorsaures Alkali beim Hunde, und beim
Schafe, if
d. Sehr wenig schwefelsaüres Alkali beim Hunde und Schafe.
Das Alkali war mehr Natron als Kali. Die nicht im Wasser löslichen
SaJze der Asche- sind wenig kohlensaurer und phosphor-
saurer Kalk.
Aus diesen trefflichen Untersuchungen ergiebt sich die. Verschiedenheit
des pankreatischen Saftes und Speichels, denn der
Speichel enthält Schleim und Speichelstoff, im pankreatischen
Safte dagegen kommt viel Eiweiss und Käsestoff vor, kein Schleim
und wenig oder kein eigentlicher Speichelstoff, Speichel ist alkalisch,
Succus pancreat. frisch säuerlich. Der Speichel des Schafes enthält
etwas schwefelblausaures Alkali C?), der pankreatische Saft nicht'.
Die übrigen Salze sind ohngefähr dieselben. T iedemann und Gmelin
l. c. p. 25—43.
L eubet und L assaigne erhielten heim lebenden Pferde in
einer halben Stunde 3 Unzen pankreatischen Saft. Er war klar,
schmeckte salzig, reagirte alkalisch und enthielt nur -j9q- Proc. fester
Restandtheiie., die sie nach einer wie es scheint oberflächlichen
Untersuchung für dieselben wie im Speichel erklärten. Wasser 99;
thierische Materie, im Alkohol auflöslich, thierische Materie,
in Wasser auflöslich, Spuren von Eiweiss, Schleim, freie Soda,
Chlorsodium, Chlorpotassium, phosphorsaure Kalke rde 00,9.
e. Succus entericus. Ueber den Bau der den Darmsaft absondernden
Drüsen ist bereits früher gehandelt worden. Man
vergleiche besonders was pag. 490. über den ^ a u der räthsel-
haften Körper, die mau PEYEa’sche Drüsen nennt, gesagt
worden. Besondere Drüsenmassen kommen ausser jenen zweifelhaft
drüsigen Körpern im Darm der Thiere nicht vor. Der
Darmsaft ist von T iedemann und Gmelin bei hungernden Thie-
ren untersucht worden. Bei nüchternen Hunden erschien
die innere Fläche der Schleimhaut wie mit einer dünnen Lage
einer sehr consistenten, weissliehen und etwas gelbgefärbten
Materie bedeckt, und es fand sich nur sehr wenig ergossene
Galle. Wenn Kieselsteine oder Pfeffer verschluckt worden,
so war eine; grössere Menge eines dünnen und fadenziehenden
Schleimes vorhanden, und die Galle war reichlicher ergossen.
Die schleimige Masse wurde nach unten im Dünndarm consisten-
ter und gelblich oder gelbbraun, es zeigten sich in ihr grüngelbe
oder gelbbraune Flocken, ans Darmschleim, Gallenschleim,
Harz, Fett und Färbestoff der Galle bestehend, Die schleimige
Flüssigkeit des Dünndarms der Hunde und Pferde enthält im ersten
Drittheil oder in der ersten Hälfte: 1. etwas freie Säure,
im Fortgange des Dünndarms ward sie meist indifferent, und bei
den Pferden enthielt sie doppelt kohlensaures Natron. Die Flüssigkeit
des Dünndarms enthielt auch 2. viel Eiweissstoff, wahrscheinlich
vom Succus pancreaticus; 3. bei den Pferden ferner
eine dem Käsestoff ähnliche Materie und 4. eine durch salzsaures
Zinn fällbare Materie beim Pferde, wahrscheinlich Speichelstoff
und Osmazom; 5. eine durch Chlor und Sublimat sich röthende
Materie bei Pferden. 6 . wenig Gallenharz bei Pferden.
7. im obern Theil des Dünndarms der Pferde eine stickstofffreie
schwachsaure Materie. Ausserdem die gewöhnlichen Salze thie-
rischer Flüssigkeiten. T iedemann und Gmelin die Verdauung.
I. p. 157.
Der Schleim des Blinddarms reagirte bei allen untersuchten
Hunden sauer. Im Blinddarm der Pferde dagegen fand sich
statt freier Säure doppelt kohlensaüres Natron. Viridet (de
prima coctione) hatte im Blinddarm der Kaninchen gleiche saure
Reaction, wie im Magen gefunden.
Ueber die saure Reaction in dem Blinddärme der Thiere hat
S chultz weitere Versuche angestellt. Er fand bei den Tbieren,
wenn sie fasteten, leichter eine alkalische oder neutrale Beschaffenheit
der Flüssigkeiten im Blinddärme, was er aus der Neutralisation
durch die während des Fastens weiter bewegte Galle erklärt,
sonst aber und während der Verdauung reagirte die
Flüssigkeit saueri Diese Reaction findet sich indess gewöhnlich
hei den pflanzenfressenden Thieren, die mit einem langem Blinddarm
ausgestattet sind, dagegen sie bei den Fleischfressern mit
unvollkommenem Blinddärme meistens fehlt. Die Saturation der