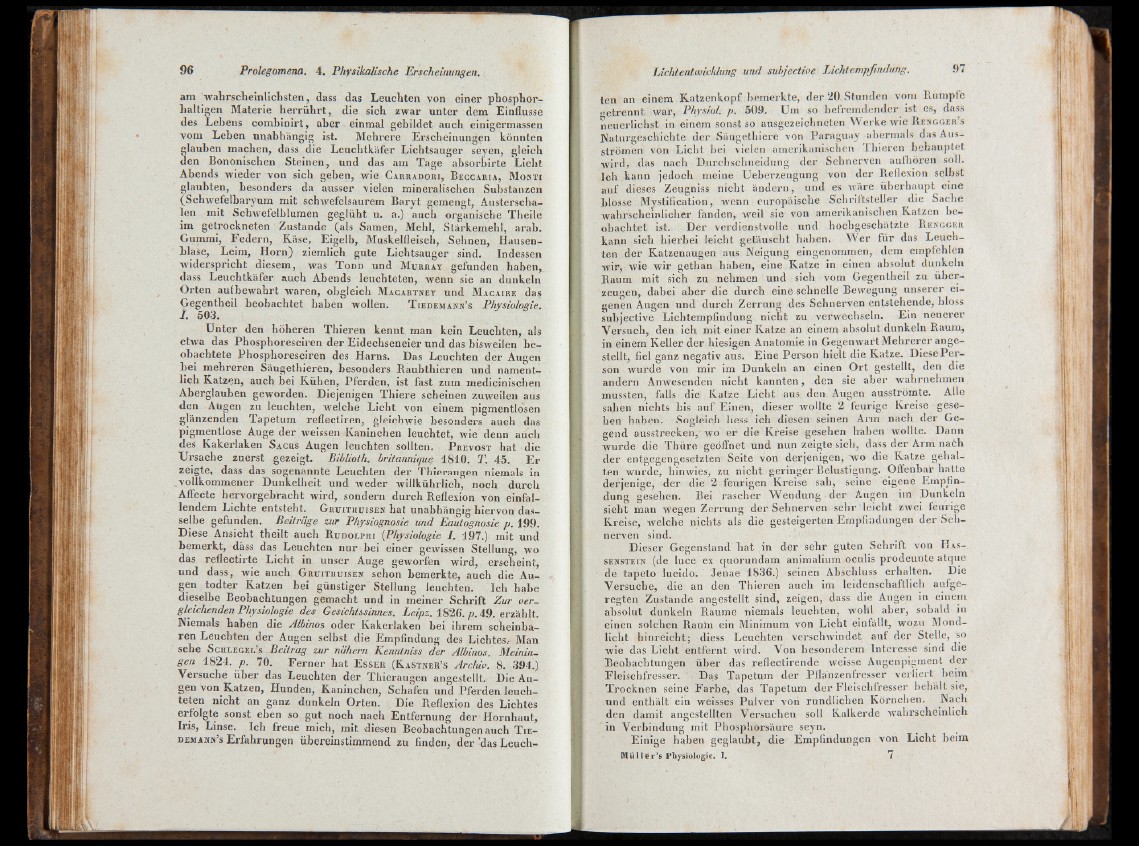
am wahrscheinlichsten, dass das Leuchten von einer phosphorhaltigen
Materie herrührt, die sich zwar unter dem Einflüsse
des Lebens comhinirt, aber einmal gebildet, auch einigermassen
vom Leben unabhängig ist. Mehrere Erscheinungen könnten
glauben machen, dass die Leuchtkäfer Lichtsauger seyen, gleich
den Bononischen Steinen, und das am Tage absorbirte Licht
Abends wieder von sich geben, wie Carradori, Beccaria, Mokti
glaubten, besonders da ausser vielen mineralischen Substanzen
(Schwefelbaryum mit schwefelsaurem Baryt gemengt, Austerschalen
mit Schwefelblumen geglüht u. a.) auch organische Theile
im getrockneten Zustande (als Samen, Mehl, Stärkemehl, arab.
Gummi, Federn, Käse, Eigelb, Muskelfleisch, Sehnen, Hausen-
blaSe, Leim, Horn) ziemlich gute Lichtsauger sind. Indessen
widerspricht diesem, was T odd und Murray gefunden haben,
dass Leuchtkäfer auch Abends leuchteten, wenn sie an dunkeln
Orten aufbewahrt waren, obgleich Macartkey und M acaire das
Gegentheil beobachtet haben wollen. T iedemann’s Physiologie.
1 503.
Unter den höheren Thieren kennt man kein Leuchten, als
etwa das Phosphoresciren der Eidechseneier und das bisweilen beobachtete
Phosphoresciren des Harns. Das Leuchten der Augen
bei mehreren Säugethieren, besonders Raubthieren und namentlich
Ratzen, auch bei Rühen, Pferden, ist fast zum medicinischen
Aberglauben geworden. Diejenigen Thiere scheinen zuweilen aus
den Augen zu leuchten, welche Licht von einem pigmentlosen
glänzenden Tapetum reflectiren, gleichwie besonders auch das
pigmentlose Auge der weissen Raninchen leuchtet, wie denn auch
des Rakerlaken S achs Augen leuchten sollten. P revost hat die
Ursache zuerst gezeigt. Biblioth. britannique 1810. T. 4 5 . Er
zeigte, dass das sogenannte Leuchten der Thieraugen niemals in
.vollkommener Dunkelheit und weder willkührlich, noch durch
Affecte hervorgebracht wird, sondern durch Reflexion von einfallendem
Lichte entsteht. Gruithuisek hat unabhängig hiervon dasselbe
gefunden. Beiträge zur Physiognosie und Eautognosie, p. 199.
Diese Ansicht theilt auch R udolphi {Physiologie I. 197.) mit und
bemerkt, dass das Leuchten nur bei einer gewissen Stellung, wo
das reflectirte Licht in unser Auge geworfen wird, erscheint,
und dass, wie auch G ruithuisen schon bemerkte, auch die Augen
todter Ratzen bei günstiger Stellung leuchten. Ich habe
dieselbe Beobachtungen gemacht und in meiner Schrift Zur vergleichenden
Physiologie des Gesichtssinnes. Leipz. 1826. p. 49, erzählt.
Niemals haben die Albinos oder Rakerlaken bei ihrem scheinbaren
Leuchten der Augen selbst die Empfindung des Lichtes.- Man
sehe S chlegel’s Beitrag zur nähern Kenntniss der Albinos. Meiningen
1824. p. 70. Ferner hat E sser (K astker’s Archiv. 8 . 394.)
Versuche über das Leuchten der Thieraugen angestellt. Die Augen
von Ratzen, Hunden, Raninchen, Schafen und Pferden leuchteten
nicht an ganz dunkeln Orten. Die Reflexion des Lichtes
erfolgte sonst eben so gut noch nach Entfernung der Hornhaut,
Ins, Linse. Ich freue mich, mit diesen Beobachtungen auch T ie-
demahh’s Erfahrungen übereinstimmend zu finden, der 'das Leuchten
an einem Ratzenkopf bemerkte, der 20 Stunden vom Rumpfe
getrennt war, Physiol. p. 509. Um so befremdender ist es, dass
neuerlichst in einem sonst so ausgezeichneten Werke wie R ergger’s
Naturgeschichte der Säugethiere von Paraguay abermals das Ausströmen
von Liebt bei vielen amerikanischen Thieren behauptet
wird, das nach D.urchschneidung der Sehnerven aufhören soll.
Ich kann jedoch meine Ueberzeugung von der Reflexion selbst
auf dieses Zeugniss nicht ändern, und es wäre überhaupt eine
blosse Mystification, wenn europäische Schriftsteller die Sache
wahrscheinlicher fanden, weil sie von amerikanischen Ratzen beobachtet
ist. Der verdienstvolle und hochgeschätzte R engger
kann sich hierbei leicht getäuscht haben. Wer für das Leuchten
der Ratzenaugen aus Neigung eingenommen, dem empfehlen
wir, wie wir gethan haben, eine Ratze in einen absolut dunkeln
Raum mit sich zu nehmen und sich vom Gegentheil zu überzeugen,
dabei aber die durch eine schnelle Bewegung unserer eigenen
Augen und durch Zerrung des Sehnerven entstehende, bloss
subjective Lichtempfindung nicht zu verwechseln. Ein neuerer
Versuch, den ich mit einer Ratze an einem absolut dunkeln Raum,
in einem Relier der hiesigen Anatomie in Gegenwart Mehrerer angestellt,
fiel ganz negativ aus. Eine Person hielt die Ratze. DiesePer-
son wurde von mir im Dunkeln an einen Ort gestellt, den die
andern Anwesenden nicht kannten, den sie aber wahrnehmen
mussten, • falls die Ratze, Licht aus den. Augen ausströmte. Alle
safien nichts bis auf Einen, dieser wollte 2 feurige Kreise gesehen
haben. Sogleich liess ich diesen seinen Arm nach der Gegend
ausstrecken, wo er die Kreise gesehen haben wollte. Dann
wurde die Thüre geöffnet und nun zeigte sich, dass der Arm nach
der entgegengesetzten Seite von derjenigen, wo die Ratze gehalten
wurde, hin wies, zu nicht geringer Belustigung. Offenbar hatte
derjenige, der die 2 feurigen Kreise sah, seine eigene Empfindung
gesehen. Bei rascher Wendung , der Augen im Dunkeln
sieht man wegen Zerrung der Sehnerven sehr leicht zwei feurige
Kreise, welche nichts als die gesteigerten Empfindungen der Sehnerven
sind.
Dieser Gegenstand hat in der Sehr guten Schrift von H as-
sensteik (de luce ex quorundam animalium oculis prodeunte atque
de tapeto lueido. Jenae 1836.) seinen Abschluss erhalten. Die
Versuche, die an den Thieren auch im leidenschaftlich aufgeregten
Zustande angestellt sind, zeigen, dass die Augen in einem
absolut dunkeln Raume niemals leuchten, wohl aber, sobald in
einen solchen Rautn ein Minimum von Licht einfällt, wozu Mondlicht
hinreicht; diess Leuchten verschwindet auf der Stelle, so
wie das Licht entfernt wird. Von besonderem Interesse sind die
-Beobachtungen über das reflectirende weisse Augenjügment der
Fleischfresser. !, Da.s Tapetum der Pflanzenfresser verliert beim
Trocknen seine Farbe, das Tapetum der Fleischfresser behalt sie,
und enthält ein weisses Pulver voii rundlichen Körnchen. Nach
den damit angestellten Versuchen soll Kalkerde wahrscheinlich
in Verbindung mit Phosphorsäure seyn.
Einige haben geglaubt, die Empfindungen von Licht beim
M ü lle r's Physiologie. I. 7