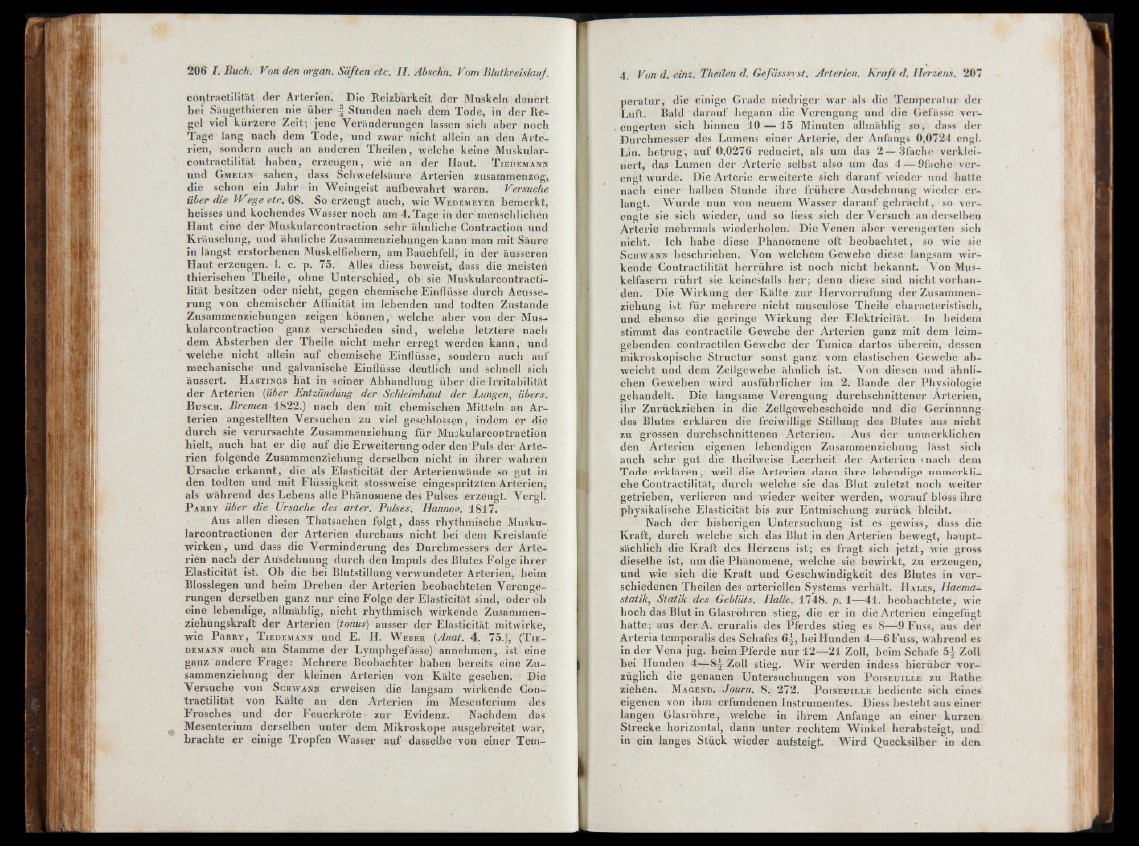
contractilität der Arterien. Die Reizbarkeit der Muskeln dauert
bei Säugethieren nie über £ Stunden nach dem Tode, in der Regel
viel kürzere Zeit; jene Veränderungen lassen sieb aber noch
Tage lang nach dem Tode, und zwar nicht allein an den Arterien,
sondern auch an anderen Theilen, welche keine Muskular-
contractilität haben, erzeugen, wie an der Haut. T iedbmann
und Q melin sahen, dass Schwefelsäure Arterien zusammenzog,
die schon ein Jahr in Weingeist aufbewabrt waren. Versuche
über die Wege etc. 68 . So erzeugt auch, wie W edemeyer bemerkt;
heisses und kochendes Wasser noch am 4. Tage in der menschlichen
Haut eine der Muskularcontraction sehr ähnliche Contraction und
Kräuselung, und ähnliche Zusammenziehungen kann man mit Säure
in längst erstorbenen Muskelfiebern, am Bauchfell,' in der äusseren
Haut erzeugen. 1. c. p. 75. Alles diess beweist, dass die meisten
thierischen Theile, ohne Unterschied, ob sie Muskularcontracti-
lität besitzen oder nicht, gegen chemische Einflüsse durch Aeusse-
rung von chemischer Affinität im lebenden und todten Zustande
Zusammenziehungen zeigen können, welche aber von der Muskularcontraction
ganz verschieden sind, welche letztere nach
dem Absterben der Theile nicht mehr erregt werden kann, und
welche nicht allein auf chemische Einflüsse, sondern auch auf
mechanische und galvanische Einflüsse deutlich und schnell sich
äussert. H astings hat in seiner Abhandlung über die Irritabilität
der Arterien (über Entzündung der Schleimhaut der Lungen, übers.
Busen. Bremen 1822.) nach den mit chemischen Mitteln an Arterien
angestellten Versuchen zu viel geschlossen, indem er die
durch sie verursachte Zusammenziehung für Muskularcontraction
hielt, auch hat er die auf die Erweiterung oder den Puls der Arterien
folgende Zusammenziehung derselben nicht in ihrer wahren
Ursache erkannt, die als Elasticität der Arterienwände so gut in
den todten und mit Flüssigkeit stossweise eingespritzten Arterien,
als während des Lebens alle Phänomene des Pulses erzeugt. Vergl.
P arry über die Ursache des art er. Pulses. Hannov. 1817.
Aus allen diesen Thatsachen folgt, dass rhythmische Musku-
larcontractionen der Arterien durchaus nicht bei dem Kreisläufe
wirken, und dass die Verminderung des'Durchmessers der Arterien
nach der Ausdehnung durch den Impuls des Blutes Folge ihrer
Elasticität ist. Ob die hei Blutstillung verwundeter Arterien, beim
Blosslegen und beim Drehen der Arterien beobachteten Verengerungen
derselben ganz nur eine Folge der Elasticität sind; oder ob
eine lebendige, allmählig, nicht rhythmisch wirkende Zusammenziehungskraft
der Arterien (tonus) ausser der Elasticität mitwirke,
wie PaRRY, T iedemann .und E. H. W eber [Anat. 4. 75.), (T iedemann
auch am Stamme der Lymphgefässe) annehmen, ist eine
ganz andere Frage: Mehrere Beobachter haben bereits eine Zusammenziehung
der kleinen Arterien von Kälte gesehen. Die
Versuche von S chwann erweisen die langsam wirkende Con-
tractilität von Kälte an den Arterien im Mesenterium des
Frosches und der Feuerkröte zur Evidenz. Nachdem das
Mesenterium derselben unter dem Mikroskope ausgebreitet war,
brachte er einige Tropfen Wasser auf dasselbe von einer Temperatur,
die einige Grade niedriger war als die Temperatur der
Luft. Bald darauf begann die Verengung und die Gefässe verengerten
sich hinnen 10 — 15 Minuten allmählig so, dass der
Durchmesser des Lumens einer Arterie, der Anfangs 0,0724 engl.
Lin. betrug', auf 0,0276 reducirt, als um das 2—3fache verkleinert,
das Lumen der Arterie selbst also um das 4 — öfache verengt
wurde. Die Arterie erweiterte sich darauf wieder und hatte
nach einer halben Stunde ihre frühere Ausdehnung wieder erlangt.
W'urde nun von neuem Wasser darauf gebracht, so verengte
sie sich wieder, und so liess sich der Versuch an derselben
Arterie mehrmals wiederholen. Die Venen aber verengerten sich
nicht. Ich habe diese Phänomene oft beobachtet, so wie sie
S chwann beschrieben. Von welchem Gewebe diese langsam wirkende
Contractilität herrühre ist noch nicht bekannt. Von Muskelfasern
rührt sie keinesfalls her; denn diese sind nicht vorhanden.
Die Wirkung der Kälte zur Hervorrufung der Zusammenziehung
ist für mehrere nicht musculöse Theile characteristisch,
und eSenso die geringe Wirkung der Elektricität. In beidem
stimmt das contractile Gewebe der Arterien ganz mit dem leimgebenden
contractilen Gewebe der Tunica dartos überein, dessen
mikroskopische Structur sonst ganz vom elastischen Gewebe abweicht
und dem Zellgewebe ähnlich ist. Von diesen und ähnlichen
Geweben wird ausführlicher im 2. Bande der Physiologie
gehandelt.. Die langsame Verengung durchschnittener Arterien,
ihr Zurückziehen in die Zellgewebescheide und die Gerinnung
des Blutes erklären die freiwillige Stillung des Blutes aus nicht
zu grossen durchschnittenen Arterien. Aus der unmerklichen
den Arterien eigenen lebendigen Zusammenziehung lässt sich
auch sehr gut die theilweise Leerheit der Arterien > nach dem
Tode erklären, weil die Arterien dann ihre lebendige unmerkliche
Contractilität, durch welche sie das Blut zuletzt noch weiter
getrieben, verlieren und wieder weiter werden, worauf bloss ihre
physikalische Elasticität bis zur Entmischung zurück bleibt.
Nach der bisherigen Untersuchung ist es gewiss, dass die
Kraft; durch welche sich das Blut in den Arterien bewegt, hauptsächlich
die Kraft des Herzens ist; es fragt sich jetzt, wie gross
dieselbe ist; um die Phänomene, welche , sie bewirkt, zu erzeugen,
und wie sich die Kraft und Geschwindigkeit des Blutes in verschiedenen
Theilen des arteriellen Systems verhält. I I ales, Haema-
statik, Statik des Geblüts. Halle. 1748. p. 1—41. beobachtete, wie
hoch das Blut in Glasröhren stieg, die er in die Arterien eingefügt
hatte; aus der A. cruralis des Pferdes stieg es 8—9 Fuss, aus der
Arteria temporalis des Schafes 6 ;), hei Hunden 4— 6 Fuss, während es
in der Vena jug. beim Pferde nur 12—21 Zoll, heim Schafe 5-j Zoll
bei Hunden 4—8 ^ Zoll stieg. Wir werden indess hierüber vorzüglich
die genauen Untersuchungen von P oiseuille zu Rathe
ziehen. Magend. Journ. 8 .; 272. P oiseuille bediente sich eines
eigenen von ihm erfundenen Instrumentes. Diess besteht aus einer
langen Glasröhre, welche in ihrem Anfänge an einer kurzen
Strecke horizontal, dann unter rechtem Winkel herabsteigt, und
in ein langes Stück wieder aufsteigt. Wird Quecksilber in den