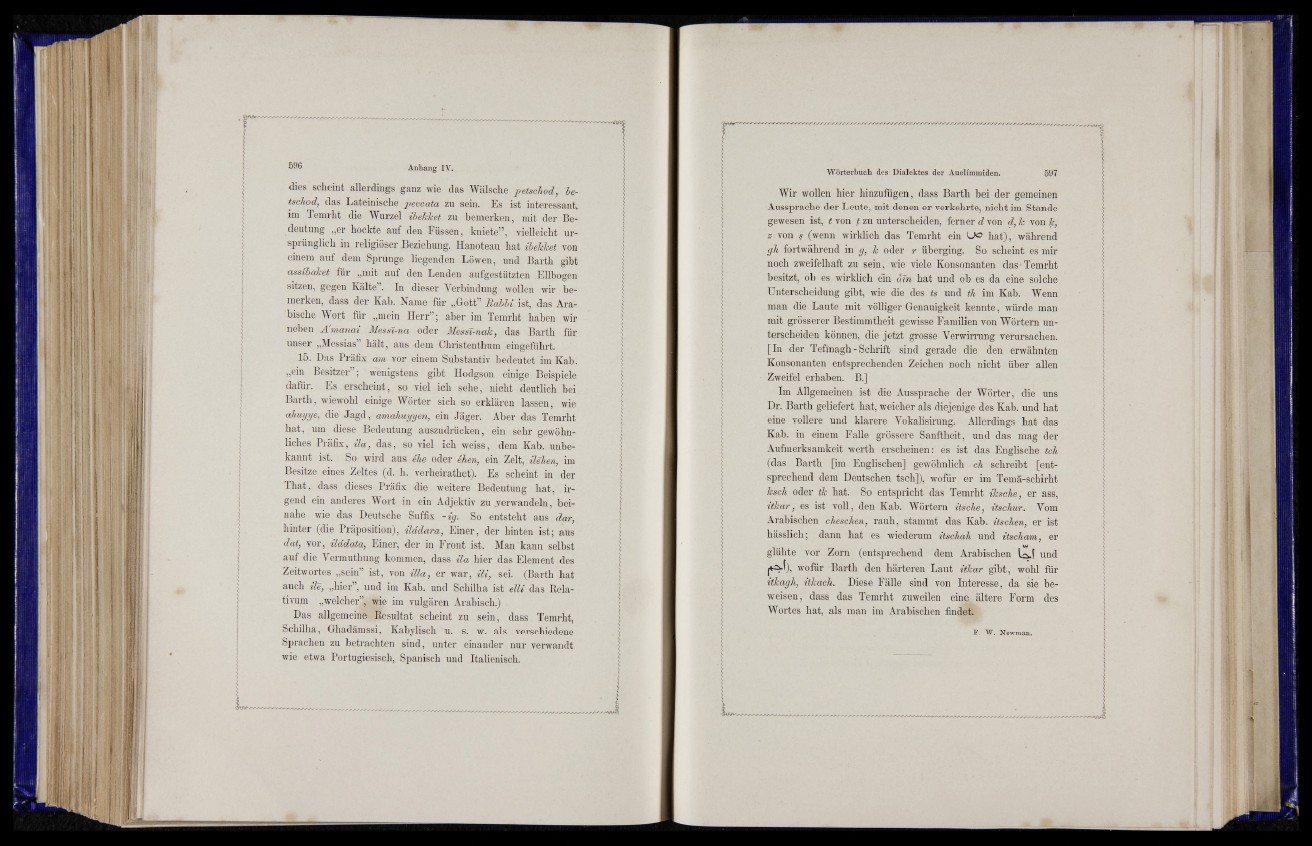
§9®. ' Anhang IV...
•<hes,s#iek;f allerdings .-ganz wie das 'Welsche' p e iso h b k ^ i^
Uhliod, das Jj^tejnis.elkß ^penbata jzu sein. .Es4, ist interessant1!
im .Temrijt 'Wurzel ibekket zu. bemerken:,, mit der Be-
((feuttmg-'^er -heckte a u f,den Rüssen, ’kniete! v -^ lte ic lit -ur^
sPCÜngKck/,in>reä^iösef ^Beziehung. Hanoteau’ Hi-ihekket »von
einem .auf dem-Sprunge liegenden',Löwen, und Barth -gilä'
ns^aÄ«%vi^Ssi||^% i^ £ 'e den 'Lenden ^u%e.stiitzten -.Ellbogen
'sitzen, gegen Kalte”. In dieser ^»bindun^j wollen -wir 'hei-
,xnerken,;,dass der- Kab.h|iame für ,M ^ n;^abbl.}s\. das Ara-
! .b|.s&he Wort.,^r'^mein: aönrf^1aber: 'im^Xenü^ht,,'•bal^p^ wir
. neben .4W W i¥ess*-w« oder «.Mtssss&a#, das Barth 4 üp.,-
unser „Messias”, h ä lt • äjis dem Christenthnm^m^dfutet. ,< W
Präfix: am vor -eäsem- Substantiv bedeutet ira^yV
»«in f t | i ^ r ” ; ^wenigstens* gibt Hodgsem emg^speisgieie.
dafür. .- Es erscheint, s© •'viel * -ich sehe, -rd^ld-^ewSliGln bei
Barth, wiewohl iepdgerWört&r pich ® > - e r k l ä r e n w i e
alpupybi die jJ*agd, aniahmfy&n^Mii. Jäger., J Aber: dah^Temrbt
hat, umv diese Bedeutung-'auszudrücken.,J*einase% gewöhn:-
ila, das, so-vieLjSchs weiss,• dem■ Kah-«uÄbel
k a n n t e t .* ^Idswird .ans •AhetßA^:4henjlßib^^\\, JlehnifinvL
Besitze „eines Zeltes ‘(di, jh. verheirathet). , Es;,scheint in v ie r
Tbatj.dass dieses- .Präfix die weitereBedeutung <,hat, fe:
ge^I ;^ a n d b r e s .Wort -in ein Adjektiv,zu jerwandeln, hei-
aahef- wie. däs. Beutsehe -;Sjidp:t - «^.'yfSjOjentsteht,
Präposition),^ddwnu-,. Einer, der-Mitten i'sC^a'Ua
dßt, vor, -ilddftia, «Einer, der in Front ist. Man kann .selbst
auf die’ Yermuthung kommen,) dass 'kß .hier das Element! de,s
ZeitWortes;*s^in” ist, von üla} er,war, sek- (Barth,hat
auch^»„Hier.” ^uud im Kab. und EcMlha %%:Mi das Belar
tivum „■syelchei^äg&ie im vulgären Arabisch!) r
Bas allgemeifl^pesultat scheint zu), sein, dass Temnhtj
Schilha ,•1 Ghadämesi, Kabyliscb u, s. uw. als" verschieden®
Spra(h#)Jija/hetra<?hten sind, unter einander nur verwandt
wie etwa Portugiesisch, Spanisch und Italienisch.
Wir wollen hier hinzufiigen, dass Barth hei der gemeinen
Aussprache der Leute, mit denen er’verkehrte, niehtim Stande
gewesen ist, t von ^.zu unterscheiden, ferne,?'d von ctffäkycm k-,
%i#bn s (wenn wirklich das Temrht ein Uo hat) , während
gh fprtwäÜfend in gf ,fo oder r^übergib^.-vSo schemt es mir
hoch zweifelhaft zu sein, wie viele Konsonähten' das • Tenirht
besitzt, oh’«es wirklich eii&dfM hat und ob’ es .da eine solche
.Unterscheidung gibt, wie'die des4fe und th im Kab. Wenn
man die Laute mit “völliger Genauigkeit-kennte, würde-man
mitJgröss'erer Bestimmtheit, gewisse Familienwön Wörtern unterscheiden
können, die-jetzt'grosse Verwirrung verursachen.
[In -der• -Tefniaghr Schrift sind gerade Üe- den erwähnten
Konsonanten entsprechenden Zeichen hoch- nicht, über allen
Zweifel ’ erhaben. ■ B/]l®H
Im Allgemeinen ist'dip Aussprache der Wörter ,5-die uns
Er’: Barth geliefert,hat; weicher als diejenige- des Kah. und hat
eine'1- vollere und klarere Vokalis irung..£ .Allerdings h a t das
Kah: in einem. Falle grössere-Sanftheit, und das mag der
Aufmerksamkeit werth ersohementllies jpp das Englische ich
‘(das Barth prin Englischen] gewöhnlich ch schreibt [entsprechend
dem" Deutschen tsch]), wofür er im Temä-schirht
ksoh oder ik hat..-So entspricht das Temrht iksche, er ass,
itkdr, !-es' is t" voll,- den- Kah:| Wörtern itsche, itschur. Vom
Arabischen cheschen, rauh, stammt-das Kah. itschen, er ist
hässlich; } dann hat es wiederum itschah und itscham, er
glühte vor Zorn (entsprechend dem Arabischen l-yf und
(%a-f), wofür -Barth den härteren Laut itfcar gibt, wohl für
ttkagh, itkach. Diese Fälle sind von Interesse, da sie be-
weisen, dass das Temrht zuweilen eine^ältere Form des
Wortes hat, als man im Arabischen findp»-
F. W. Kewman.