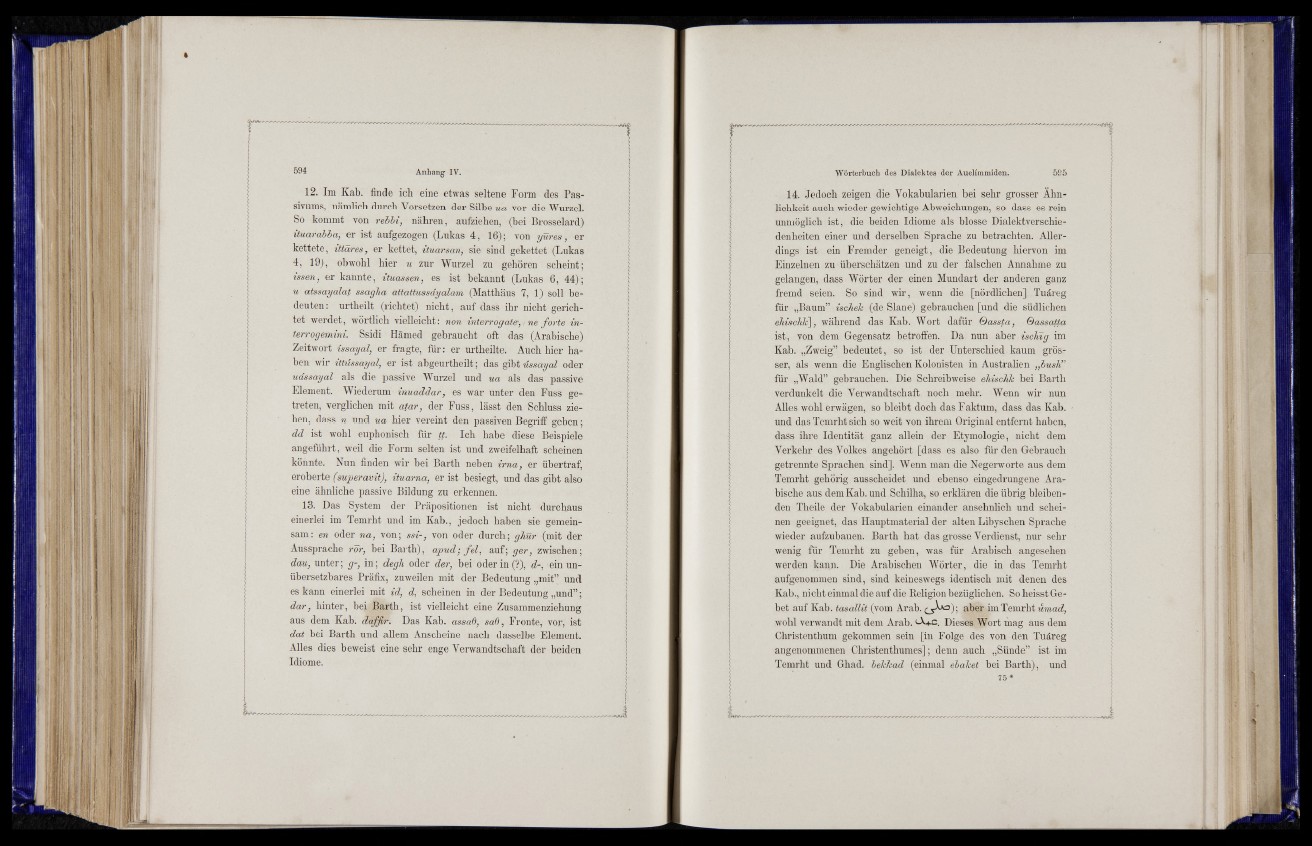
12. Im Kab'. finde ich eine etwas seltene '.Form des Pas-
sivüms, nämlich durch Vorsetzen der Silbe ua vor die Wurzel.
So -kommt von rebbi, nähren, aufziehen, (bei Brosselard)
ituarabba, eT ist aufgezogen (Lukas 4, 16);,- von yures, ' er
kettete, tttäres, er kettet, ituarsan, sie' sind gekettet (Lukäs
4, 19)V"’ obwohl hier u zur Wurzel zu gehören scheint-)’
issen, er kannte, ituassen, es'-ist bekannt (Lukas. -6, 44)A
u atssayalat ssagfia attattussayalam (Matthäus 7, »FpSc®' bedeuten:
urtheilt (richtet) nicht, auf dass'ihr nicht gerichtet
werdet, wörtlich vielleicht: non interrogate-,, ne, forte ih^
terrogemini. Ssidi Hämed gebraucht oft da-, (Arabische)
Zeitwort issäyal, er fragte, für: er urtheilte:- Aüch'hier'haben
wir ittussayal, er ist abgeurtheilt; das gibt 4ssayal oder
uassayal als die passive Wurzel und ua als das passive
Element Wiederum > inuaddar, es war unter -den F>uss' ge*,
treten, verglichen mit atar, der Fuss, lässt den ’Sbhkfes zie--
hen, dass n und ua hier vereint den passiven Begriff 'geben*;
dd ist wohl euphonisch für tt. Ich habe diese .Beispiele
angeführt, weil die Form selten ist und zweifelhaft scheinet
keimte. Nun finden wir bei Barth neben ima,' .er übertfaf,
eroberte. (Wperawiy, ituamg, er ist besiegt, und das gibt aüsb
eine älinliche passive Bildung zu erkennen.
13. Das System der Präpositionen' ist * nicht?, durchaus
einerlei im Temrht und im Eab.. jedoch haben sie gemein*-
sam: en oder na, von; ssi-, von oder durch; ghü¥ (mit der
Aussprache rör, bei Barth), apud- feil, auf; ger, zwischen“;
däu, unter; g-,.in; degh oder der, bei*öder in (?»);'$-, -ein unübersetzbares
Präfix, zuweilen mit der Bedeutung „mit” und
es kann einerlei mit id, d; scheinen in der Bedeutung „und’'*;
dar, hinter, befrlft^h vielleicht eine Ziisamme-nziehnng
aus dem 'Eäb. daffir. Das Eab. assaO, saöy.Fronte,1 vor, ist
datlIbtsi Barth und allem Anscheine nach- dasselbe Element.
Alles dies beweist eine sehr enge Verwandtschaft der-beiden
Idiome«
14. Jedoeh. zeigen-jd'ie .Vokabularien bei sehr grosser Ähnlichkeit
auch wieder,ge Wichtige Abweichungen, so. dass es rein
unmöglich-ist,. die beiden Idiome als blosse Dialektyers-chier
denbeiten ‘einer und' derselben Sprache -Zu betrachten. Aller*
.dings ist« ein Fremder g en e ig td ie Bedeutung^.hiervonj im
Einzelnen «izn-«überschätzen und zu der falschen Annahme zu
gelangen,*., dass Wörter der .einen Mundart der. anderen ganz
fremd «seieQV So. sind wir, wenn die [nördlichen},,Tuäreg
für „Baum"yischek (^A^lpne) gebrauchen [und die südlichem
ieMschk], während »das Eab. Wort dafür Oassta, Qassatta
i s t , ’dem«-Gegensatz, betroffen. Da,« nun -ahe^,ischtgy im
Eab. „Zweig!’ bedeutet, so isfei.der Unterschied»kaum gross-
ser, als wenn die Englischen Kolonisten in Australien -„bush’i
•für. .„Wald” gebrauchen.'» Die Schreibweise ehischk bei Barth
verdunkelt „die- Verwandtschaft, noch | mehr. Wenn wir nun
Alles, wohl erwägen, so bleibt doch das Faktum, dass, das Eab.
und das Temrht sieh so weit von ihrem Original entfernt haben,
däS.s-ll^e ^Identität ganz allein der, Etymologie, «nicht dem
Vmke'hr des Volkes angehört [dass.es also für den Gebrauch
getrennte Sprächen sind]. Wenn man -die Negerworte aus dem
Temrht gehörig ausscheidet und ebenso eingedrungene Arar
"bische aus dein Eab. und Schilha, so erklären die übrig bleiben-
den.» -T-h|ile. der Vokabularien einander- ansehnlich und schei-
nen »geeignet, das'Hauptmaterial der alten Libyschen Sprache
wieder aufzübauen. Barth hat das grosse Verdienst, nur sehr
wenig für Temrht zu geben, was--für Arabisch angesehen'
werden kann« Die Arabischen Wörter., die in das Temrht
taufgenommen sind, sind keineswegs identisch mit denen des
Kab., night einmal die auf die Religion bezüglichen,-.Sj.o heisst Ger
bet auf Kab. tasallit (vom Arab, aber im Temrht ümad,
Äöhl verwandt mit demArab. <A+c. DiesegpfFort mag aus dem
Christenthum gekommen sein [in Folge des von-den Tuäreg
»angenommenen Christenthumer]; denn auch „Sünde”, ist im
Temrht und Ghad. bekkad (einmal ebaket bei Barth), , und