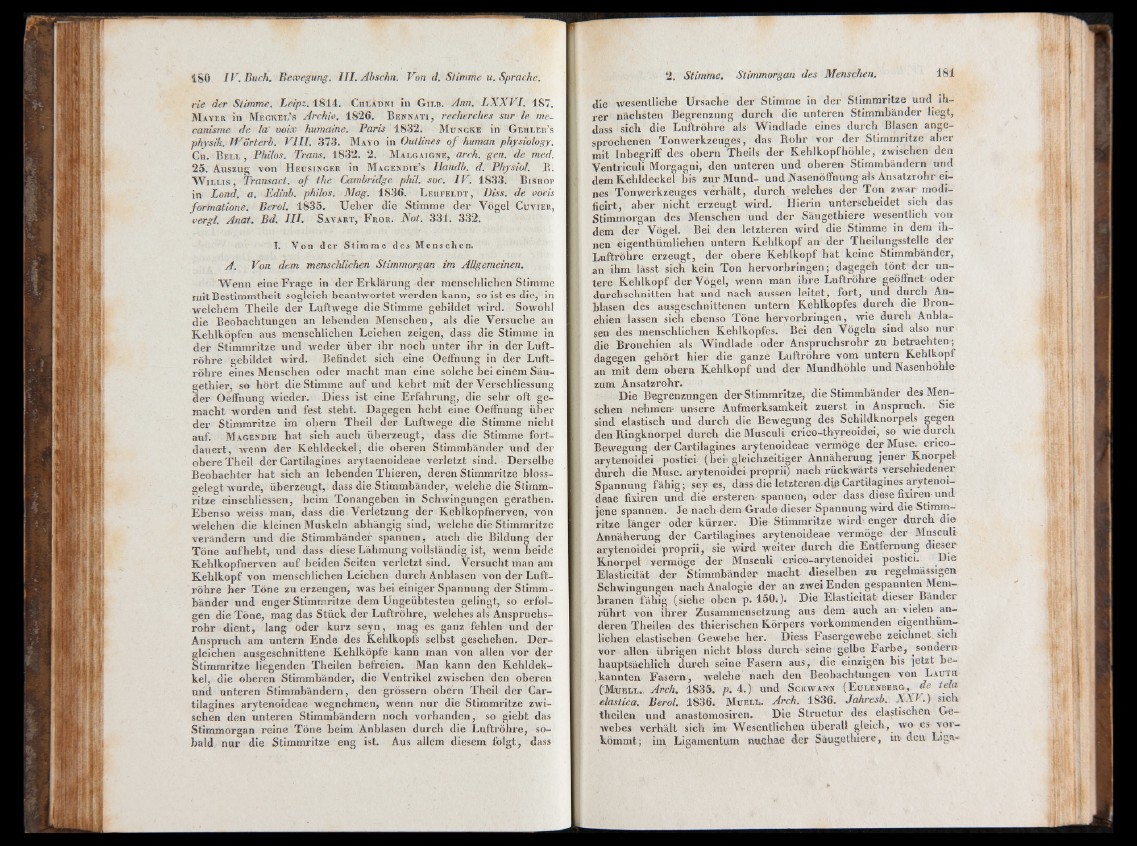
rie der Stimme. Leipz. 1814. ChEadni in Gilb. Ami. LXXVI. 187.
Mayer in Meckel’s Archiv. 1826. Bennati, recherches sur le me~
canisme de la•' ooix humaine. Paris 1832. Muncke in Gehler’s
physik. IV'orterb. VIII. 373. Mayo in Outlines o f human physiology.
Ch. Bell , Philos. Trans. 1832. 2. Malgaigne, arch. gen. de med.
25. Auszug von Heusinger in Magendie’s Handb. d. Physiol. p
W illis, Transact. of the Cambridge phil. soc. IV. 1833. Bishop
in Lond. a. Edinb. philos. Mag. 1836. Lehfeldt, Diss. de vocis
formatione. Berol. 1835. Ueber die Stimme der Vögel Cuvier,
vergl. Anat. Bd. III. Savart, F ror. Not. 331. 332.
I. Von der Stimme des Menschen.
A. Von dem menschlichen Stimmorgan im Allgemeinen.
Wenn eine Frage in der" Erklärung der menschlichen Stimme
mit Bestimmtheit sogleich beantwortet werden kann, so ist es die, in
welchem Theile der Luftwege die Stimme gebildet wird. Sowohl
die Beobachtungen an lebenden Menschen, als die Versuche an
Kehlköpfen aus menschlichen Leichen zeigen, dass die Stimme in
der Stimmritze und weder über ihr noch unter ihr in der Luftröhre
gebildet wird. Befindet sich eine Oeffnung in der Luftröhre
eines Menschen oder macht man eine solche bei einem Säugethier,
so hört die Stimme auf und kehrt mit der Verschliessung
der Oeffnung wieder. Diess ist eine Erfahrung, die sehr oft gemacht
worden und fest steht. Dagegen hebt eine Oeffnung über
der Stimmritze im obern Theil der Luftwege die Stimme nicht
auf. Magendie hat sich auch überzeugt, dass die Stimme fortdauert,
wenn der Kehldeckel, die oberen Stimmbänder und der
obere Theil der Gartilagines arytaenoideae verletzt sind. Derselbe
Beobachter hat sich an lebenden Thieren, deren Stimmritze blossgelegt
wurde, überzeugt, dass die Stimmbänder, welche die Stimmritze
einschliessen, beim Tonangehen in Schwingungen gerathen.
Ebenso weiss man, dass die Verletzung der Kehlkopfnerven, von
welchen die kleinen Muskeln abhängig sind, welche die Stimmritze
verändern und die Stimmbänder spannen, auch die Bildung der
Töne aufheht, und dass diese Lähmung vollständig istj wenn beide
Kehlkopfnerven auf beiden Seiten verletzt sind. Versucht man am
Kehlkopf von menschlichen Leichen durch Anblasen von der Luftröhre
her Töne zu erzeugen, was bei einiger Spannung der Stimmbänder
und enger Stimmritze dem Ungeübtesten gelingt, so erfolgen
die Töne, mag das Stück der Luftröhre, welches als Anspruchsrohr
dient, lang oder kurz seyn, mag es ganz fehlen und der
Anspruch am untern Ende des Kehlkopfs selbst geschehen. Dergleichen
ausgeschnittene Kehlköpfe kann man von allen vor der
Stimmritze liegenden Theilen befreien. Man kann den Kehldek-
kel, die oberen Stimmbänder, die Ventrikel zwischen den oberen
und unteren Stimmbändern, den grossem obern Theil der Gartilagines
arytenoideae wegnehmen, wenn nur die Stimmritze zwischen
den unteren Stimmbändern noch vorhanden, so giebt das
Stimmorgan reine Töne beim Anblasen durch die Luftröhre, sobald
nur die Stimmritze eng ist. Aus allem diesem folgt, dass
die wesentliche Ursache der Stimme in der Stimmritze und ih-
rpr nächsten Begrenzung durch die unteren Stimmbänder liegt,
dass sich die Luftröhre als Windlade eines durch Blasen angesprochenen
Tonwerkzeuges, das Rohr vor der Stimmritze aber
mit Inbegriff des obern Theils der Kehlkopf höhle, zwischen den
Ventriculi Morgagni, den unteren und oberen Stimmbändern und
dem Kehldeckel bis zur Mund- und Nasenöffnung als Ansatzrohr eines
Tonwerkzeuges verhält, durch welches der Ton zwar modi-
ficirt, aber nicht erzeugt wird. Hierin unterscheidet sich das
Stimmorgan des Menschen und der Säugethiere wesentlich von
dem der Vögel. Bei den letzteren wird die Stimme in dem ihnen
eigenthümlichen untern Kehlkopf an- der Theilungsstelle der
Luftröhre erzeugt, der obere Kehlkopf hat keine Stimmbänder,
an ihm lässt sich kein Ton hervorbringen; dagegeh tönt der untere
Kehlkopf der Vögel, wenn man ihre Luftröhre geöffnet oder
durchschnitten hat und nach aussen leitet, fort, und durch Anblasen
des ausgeschnittenen untern Kehlkopfes durch die Bronchien
lassen sich ebenso Töne hervorbringen, wie durch Anblasen
des menschlichen Kehlkopfes. Bei den Vögeln sind also nur
die Bronchien als Windlade oder Anspruchsrohr zu betrachten;
dagegen gehört hier die ganze Luftröhre vom untern Kehlkopf
an mit dem obern Kehlkopf und der Mundhöhle und Nasenhöhle
zum Ansatzrohr.
Die Begrenzungen der Stimmritze, die Stimmbänder des Menschen
nehmen- unsere Aufmerksamkeit zuerst in Anspruch. Sie
sind elastisch und durch die Bewegung des Schildknorpels gegen
denRingknorpel durch die Musculi crico-tbyreoidei, so wie durch
Bewegung der Gartilagines arytenoideae vermöge der Muse, crico-
arytenoidei postier (beb gleichzeitiger Annäherung jener Knorpel
durch die Muse, arytenoidei proprii) nach rückwärts verschiedener
Spannung fähig; sey es, dass die letzteren dip Cartilagines arytenoideae
fixiren und die ersteren- spannen, oder dass diese fixiren-und
jene spannen. Je nach dem Grade-dieser Spannung wird die Stimmritze
länger oder kürzer. Die Stimmritze wird- enger durch die
Annäherung der Cartilagines arytenoideae vermöge der Musculi
arytenoidei proprii, sie wird weiter durch die Entfernung dieser
Knorpel vermöge der Musculi crico-arytenoidei postici. Die
Elasticität der Stimmbänder macht dieselben zu regelmässigen
Schwingungen nach Analogie der an- zwei Enden gespannten Membranen
fähig (siehe oben p. 150 ). Die Elasticität- dieser Bänder
rührt von ihrer Zusammensetzung aus dem auch an vielen anderen
Theilen des thierischen Körpers vorkommenden eigenthümlichen
elastischen Gewebe her. Diess Fasergewebe zeichnet sich
vor allen übrigen nicht bloss durch- seine gelbe Farbe, sonaern
hauptsächlich durch seine Fasern aus,, die einzigen bis jetzt bekannten
Fasern, welche nach den Beobachtungen von L autu
('Msuell.. Arch. 1835. p. 4.) und Schwan» ( E ulenberg, _ de tela
elastica. Berol. 1836. Muell. Arch. 1836. Jahresb. XXV.) sich
theilen und anastomosiren. Die Structur des elastischen Gewebes
verhält sich im Wesentlichen überall gleich,^ wo es voi-
kömrnt; im Ligamentum nuchae der Säugethiere, in den Liga