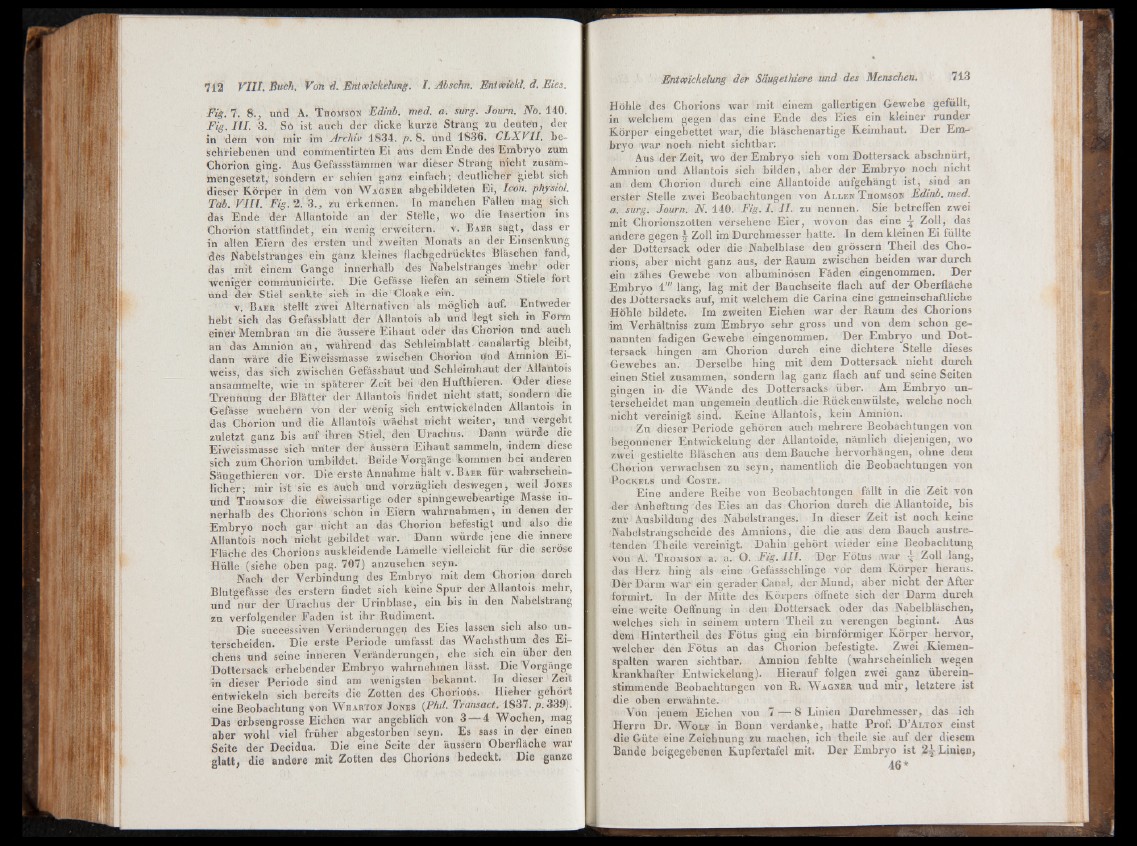
Fig. 7. 8 ., und A. T homson Edinb. rtied. a. surg. Journ. No. 140.
Fig. III. 3. Só ist auch der dicke kurze Sträng zu deuten, der
in dem von mir im Archio 1834. p. 8. und 1836. CEXVII. beschriebenen
und Commeritirten Ei aus dem Ende des Embryo zum
Chorion ging. Aus Gefässst'ämmen war dièser Strang nicht izusarti-
mengesetzt,’ sondern er schien ganz einfach; deutlicher giebt sich
dieser Körper in dèih von W agner abgebildeten Ei, Icon, physiol.
Tab. VIII. Fig. 2. 3., zu erkennen. In manchen Fällen mag sich
das Ende der Alläntoide an der Stelle, wo die Insertion ins
Chorion stattfindet, ein wenig erweitern, v. Baer sägt, dass er
in alten Eiern des ersten und zweiten Monats an der Einsenkung
des NabèlstrangeS fein ganz kleines flachgedrücktes Bläschen fand,
das mit einem Gange innerhalb des Nabelstranges mehr oder
weniger cörnmunicirte. Die Gefässe liefen an seinem Stiele fort
und der Stiel senkte sich in die Üloäke ein.
v. Baer Stellt zwei Alternativen als möglich ärtf. Entweder
hebt sich das Gefässblatt der Allantois ah ttnd legt sich in Fötm
einer Membran an die äussere Eihaut oder das Chorion und auch
an das Amnion an, während das Schleimblatt * Canälärtig bleibt,
dann wäre die Eiweissmasse zwischen Chorion Und Amnion Ei-
weiss, das sich zwischen Gefässhaüt rtnd Schleimhaut der Allantois
ansammelte, wie in späterer Zeit bei den Hufthieren. Oder diese
Trennung der Blätter der Allantois findet nicht statt, sondern die
Gefässe wuchern Von. der wenig Sich entwickelnden Allantois in
das Chorion und die Allantois wächst nicht weiter, und vergeht
zuletzt ganz bis auf ihren Stiel, den TJrachus. Dann ^ würde die
Eiweissmasse sich unter der äussCrn Eihäut sammeln, -indem diese
sich zum Chorion umbildet. Beide Vorgänge kommen bei anderen
Säugethieren vor. Die erste Annahme hält v. Baer für wahrscheinlicher;
mir ist sie eS äuteh und vorzüglich deswegen, Weil J ones
und T homson die èiweissartige oder spinngewebeartige Masse innerhalb
des Chorions schon in Eiern wahrnahmen, in denen der
E m b r y o noch gar nicht an das Chorion befestigt -und also die
Allantois noch nicht gebildet wär. Dann würde jene die innere
Fläche des Chorions auskleidende Lärtielle vielleicht für die seröse
Hülle (siehe oben pag. 707) anzusehen seyn.
Nach der Verbindung des Embryo mit dem Chorion duren
Blutgefässe des erstem findet sich keine Spur der Allantois mehr,
und nur der Urachus der Urinblase, ein bis in den Nabelstrang
zu verfolgender Faden ist ihr Rudiment.
Die successiven Veränderungen des Eies lassen sich also unterscheiden.
Die erste Periode umfasst das Wachsthnm des Eichern
und seine inneren Veränderungen, ehe sich ein über den
Dottersack erbebender Embryo wahrnehmen lässt. Die’Vorgänge
in dieser Periode sind am wenigsten bekannt. In dieser Zeit
entwickeln sich bereits die Zotten des Chorions. Hieber gehört
eine Beobachtung von W harton J ones (Phil. Transact. 1837. p. 339).
Das erbsengrosse Eichen war angeblich von 3 — 4 Wochen, mag
aber wohl viel früher abgestorben seyn. Es sass in der einen
Seite der Decidna. Die eine Seite der äussern Oberfläche war
glatt, die andere mit Zotten des Chorions bedeckt. Die ganze
Höhle des Chorions war mit einem gallertigen Gewebe gefüllt,
in welchem gegen das eine Ende des Eies ein kleiner runder
Körper eingebettet war, die bläschenartige Keimhaut. Der Embryo
war noch- nicht sichtbar;
Aus der Zeit, wo der Embryo sich vom Dottersack abschnürt,
Amnion und Allantois sich bilden, aber der Embryo noch nicht
an dem Chorion durch eine Alläntoide aufgehängt ist, sind an
erster Stelle zwei Beobachtungen von Allen T homson Edinb. med.
a. surg. Journ. N. 140. Fig. I. II. zu nennen. Sie betreffen zwei
mit Chorionszotten versehene Eier, wovon das eine \ Zoll, das
andere gegen \ Zoll im Durchmesser hatte. In dem kleinen Ei füllte
der Dottersack oder die Nabelblase den grossem Theil des Chorions,
aber nicht ganz aus, der Raum zwischen beiden war durch
ein zähes Gewebe von albuminösen Fäden eingenommen. Der
Embryo 1"' läng, lag mit der Bauchseite flach auf der Oberfläche
des Dottersacks auf, mit welchem die Carina eine gemeinschaftliche
Höhle bildete. Im zweiten Eichen war der Raum des Chorions
im Verhältniss zum Embryo sehr gross und von dem schon genannten
fadigen Gewebe eingenommen. Der Embryo und Dottersack
hingen am Chorion durch eine dichtere Stelle dieses
Gewebes an. Derselbe hing mit dem Dottersack nicht durch
einen Stiel zusammen, sondern lag ganz flach auf und seine Seiten
gingen in die Wände des Dottersacks über. Am Embryo unterscheidet
man ungemein deutlich .die Rückenwülste, welche noch
nicht vereinigt sind. Keine Allantois, kein Amnion.
Zu dieser Periode gehören auch mehrere Beobachtungen von
begonnener Entwickelung der Alläntoide, nämlich diejenigen, wo
zwei gestielte Bläschen aus dem Bauche hervorhängen, ohne dem
Chorion verwachsen zu seyn, namentlich die Beobachtungen von
P ockels und C oste.
Eine andere Reihe von Beobachtungen fällt in die Zeit von
der Anheftung des Eies an das Chorion durch die Alläntoide, bis
zur Ausbildung des Nabelstranges. In dieser Zeit ist noch keine
Naheistrangscheide des Amnions, die die aus dem Bauch austre-
‘tenden Theile vereinigt. Dahin gehört wieder eine Beobachtung
von A. T homson a. a. O. Fig. III. D e r Fötus w a r Zoll lang,
das Herz hing als eine iGefässschlinge vor dem Körper heraus.
Der Darm War ein gerader Canal, der Mund, aber nicht der After
formirt. In der Mitte des Körpers öffnete sich der Darm durch
eine weite Oeffnung in den Dottersack oder das Nabelbläschen,
welches sich in seinem untern Theil zu verengen beginnt. Aus
dem Hintertheil des Fötus ging ein bimförmiger Körper hervor,
welcher den Fötus an das Chorion befestigte. Zwei Kiemenspalten
waren sichtbar. Amnion fehlte (wahrscheinlich wegen
krankhafter Entwickelung). Hierauf folgen zwei ganz übereinstimmende
Beobachtungen von R. W agner und mir, letztere ist
die oben erwähnte.
Von jenem Eichen von 7 — 8 Linien Durchmesser, das ich
Herrn Dr. W olf in Bonn verdanke, hatte Prof. D ’Alton einst
die Güte eine Zeichnung zu machen, ich theile sie auf der diesem
Bande beigegebenen Kupfertafel mit. Der Embryo ist 2^ Linien,