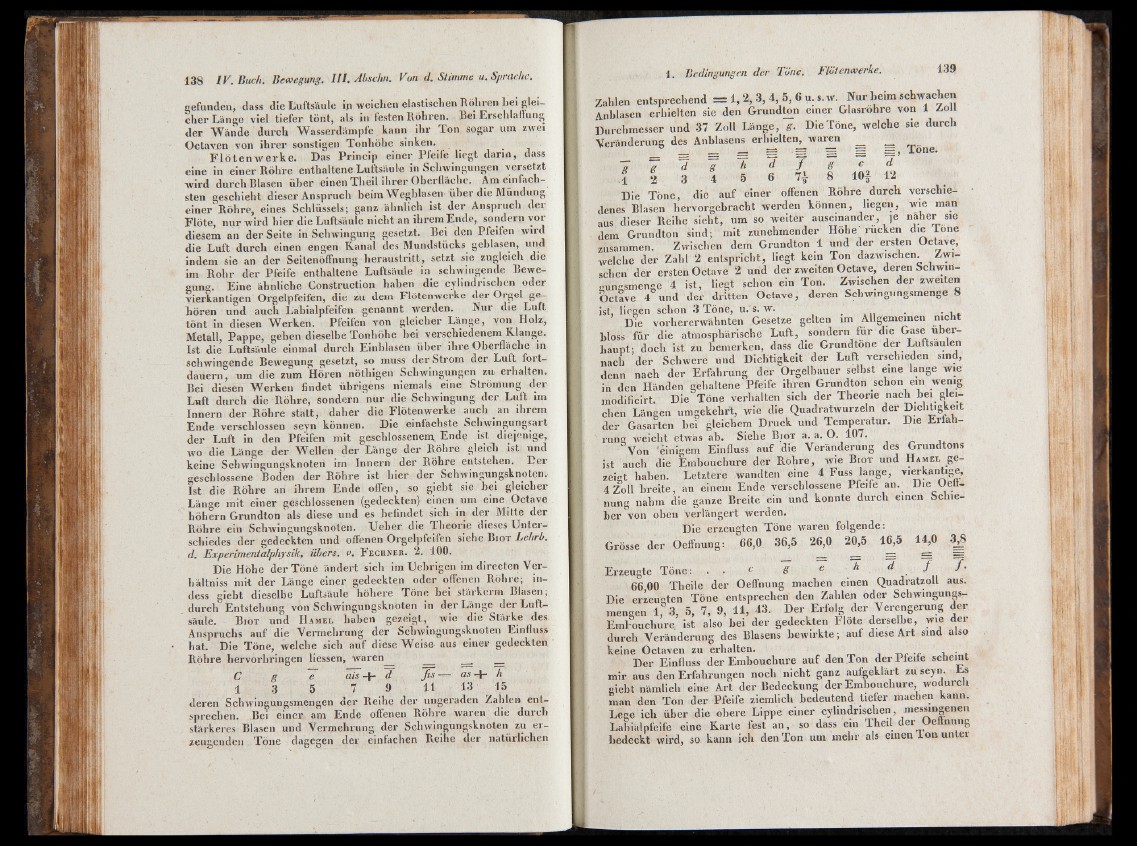
aefunden, dass die Luftsäule ip weichen elastischen Röhren hei gleicher
Länge viel tiefer tönt, als in festen Röhren. Bei Erschlaffung
der Wände durch Whsserdämpfe kann ihr Ton sogar um zwei
Octaven von ihrer sonstigen Tonhöhe sinken. ^ ,
F lö te nw e rk e . Das Princip einer Pfeife liegt dann, dass
eine in einer Röhre enthaltene Luftsäule in Schwingungen versetzt
wird durch Blasen über einen Theil ihrer Oberfläche. Am einfachsten
geschieht dieser Anspruch beim Wegblasen über die Mündung
einer Röhre, eines Schlüssels; ganz ähnlich ist der Anspruch der
Flöte, nur wird hier die Luftsäule nicht an ihrem Ende, sondern vor
diesem an der Seite in Schwingung gesetzt. Bei den Pfeifen wird
die Luft durch einen engen Kanal des Mundstücks^ gehlasen, und
indem sie an der Seitenöffnung heraustritt, setzt sie zugleich die
im Rohr der Pfeife enthaltene Luftsäule in schwingende Bewegung.
Eine ähnliche Construction haben die cylindrischen oder
vierkantigen Orgelpfeifen, die zu dem Flötenwerke der Orgel, gehören
und auch Labialpfeifen genannt werden. Nur die Luft
tönt in diesen Werken. Pfeifen von gleicher Länge, von Holz,
Metall, Pappe, geben dieselbe Tonhöhe bei verschiedenem Klange.
Ist die Luftsäule einmal durch Einblasen über ihre Oberfläche in
schwingende Bewegung gesetzt, so muss der Strom der. Luit fort-
dauern, um die zum Hören nöthigen Schwingungen zu. erhalten.
Bei diesen Werken findet übrigens niemals eine Strömung der
Luft durch die Röhre, sondern nur die Schwingung der Luft irn
Innern der Röhre statt, daher die Flötenwerke auch an ihrem
Ende verschlossen seyn können. Die einfachste Schwingungsaxt
der Luft in den Pfeifen mit geschlossenem. Ende ist diejenige,
wo die Länge der "Wellen der Länge der Röhre gleich ist u n d
keine Schwingungsknoten im Innern der Röhre entstehen. Der
geschlossene Boden der Röhre ist hier der Schwingungsknoten,
Ist die Röhre an ihrem Ende offen, so giebt sie bei gleicher
Länge mit einer geschlossenen (gedeckten) einen um eine Oetave
hohem Grundton als diese und es helindet sich in der Mitte der
Röhre ein Schwingungsknoten. TJeber die Theorie dieses Unterschiedes
der gedeckten und offenen Orgelpfeifen siehe Biot Lehrb.
d. Experimentalphysik, übers, v. F echheb. 2. 100.
Die Höhe derTönö ändert sich im Uebrigen im directen Ver-
hältniss mit der Länge einer gedeckten oder offenen Röhre; in-
dess giebt dieselbe Luftsäule höhere Töne bei stärken» Blasen;
durch Entstehung von Schwingungsknöten in der Länge der Luftsäule.
Biot und Hamel haben gezeigt, wie die Stärke des.
Anspruchs auf die Vermehrung der Schwingungsknoten Einfluss
bat. Die Töne, welche sich auf diese Weise aus einer gedeckten
Rohre hervorbringen Hessen, waren_ __ _ _
C g e ais -f- d fis as -f- h
1 3 5 7 9 11 13 15
deren Schwingungsmengen der Reihe der ungeraden Zahle» entsprechen.
.Bei einer am Ende offenen Röhre waren die durch
stärkeres Blasen und Vex’melxrung der Schwingungsknöten zu erzeugenden
Töne dagegen der einfachen Reihe iler ixatürliclien
Zahlen entsprechend = 1, 2, 3, 4, 5, 6 u. s.w. Nur beim schwachen
Anblasen erhielten sie den Grundton einer Glasrohre von 1 Zoll
Durchmesser und 37 Zoll Länge, g. Die Töne, welche sie durch
Veränderung des Anblasens erhielten, waren _ __ ,
7 T 7 ~g T i ~d ƒ J C d
1 2 3 4 5 6 7} 8 lOf 12
Die Töne, die auf einer offenen Röhre durch verschiedenes
Blasen hervorgebracht werden können, liegen, wie man
aus dieser Reihe sieht, um so weiter auseinander, ]e näher sie
dem Grundton sind; mit zunehmender Höhe rucken die lone
zusammen. Zwischen dem Grundton 1 und der ersten Oetave,
welche der Zahl 2 entspricht, liegt kein Ton dazwischen. Zwischen
der ersten Oetave 2 und der zweiten Oetave, deren Schwm-
aungsmenge 4 ist, liegt schon ein Ton. Zwischen der zweiten
Oetave 4 und der dritten Oetave, deren Schwxngungsmenge 8
ist, liegen schon 3 Töne, u.'s. w. ,f . . . . • • , f
Die yorhererwähnten Gesetze gelten im Allgemeinen nicht
bloss für die atmosphärische Luft, sondern für die Grase überhaupt;
doch ist zu bemerken, dass die Grundtöne der Luftsäulen
nach der Schwere und Dichtigkeit der Luft verschieden sind,
denn nach der Erfahrung der Orgelbauer selbst eine lange wie
in den Händen gehaltene Pfeife ihren Grundton schon ein wenig
modificirt. Die Töne verhalten sich der Theorie nach bei gleichen
Längen umgekehrt, wie die Quadratwurzeln der Dichtigkeit
der Gasarten bei gleichem Druck und Temperatur. Die Erfahrung
weicht etwas ab. Siehe Biot a. a. 0 .1 0 7 .
Von 'einigem Einfluss auf die Veränderung des Grundtons
ist auch die Embouchure der Röhre, wie Biot und Hamel gezeigt
haben. Letztere wandten eine 4 Fuss lange, vierkantige,
4 Zoll breite, an einem Ende verschlossene Pfeife an. Die Oeii-
nung nahm die ganze Breite ein und konnte durch einen Schieber
von oben verlängert werden.
Die erzeugten Töne waren folgende:
Grösse der Oeffnung: 66,0 36,5 26,0 20,5 16,5 14,0 33
, Erzeugte Töne: . - % ~§ e h d t
66 00 Theile der Oeffnung machen einen Quadratzoll aus.
Die erzeugten Töne entsprechen den Zahlen öder Schwingungsmengen
1, 3, 5, 7, 9, 11, 43. Der Erfolg der Verengerung der
Embouchure, ist also bei der gedeckten Flöte derselbe, wie dei
durch Veränderung des Blasens bewirkte; auf diese Art sind also
keine Octaven zu erhalten. .. , . ,
Der Einfluss der Embouchure auf den Ton der Pfeife scheint
mir aus den Erfahrungen noch nicht ganz aufgeklärt zu seyn. Es
giebt nämlich eine Art der Bedeckung der Embouchure, wodurch
man den Ton der Pfeife ziemlich bedeutend tiefer machen Kann.
Lege ich Über die obere Lippe einer cylindrischen, messingenen
Labiälpfeife eine Karte fest an, so dass ein Theil der Oeffnung
bedeckt wird, so kann ich den Ton um mehr als einen Ton unter