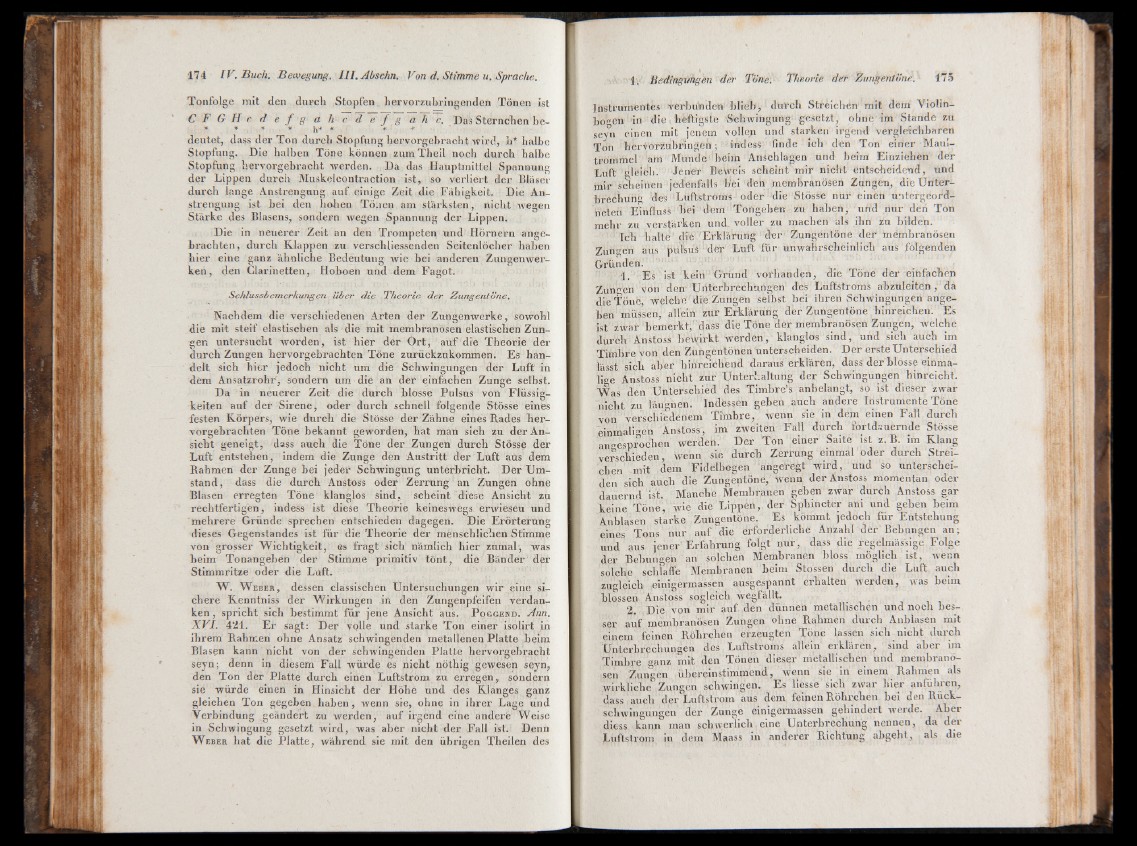
Tonfolge mit den durch Stopfen hervorzubringenden Tönen ist
C F G H c d e f g a h c d e f g a h ' c. Das Sternchen be-
* * .. * . * h* * ' *
deutet, dass der Ton durch Stopfung hervorgebracht wird, h* halbe
Stopfung. Die halben Töne können zum Tbeil noch durch halbe
Stopfung hervorgebracht werden. Da das Hauptmittel Spannung
der Lippen durch Muskelcontraction ist, so verliert der Bläser
durch lange Anstrengung auf. einige Zeit die Fähigkeit. Die Anstrengung
ist bei den hohen Töaen am stärksten, nicht wegen
Stärke des Blasens, sondern wegen Spannung der Lippen,
Die in neuerer Zeit an den Trompeten und Hörnern angebrachten,
durch Klappen zu verschliessenden Seitenlöcher haben
hier eine ganz ähnliche Bedeutung wie bei anderen Zungenwerken,
den Clarinetten, Hoboen und dem Fagot.
Sc/dussbemerkungen über die Theorie der Zungentöne,
Nachdem die verschiedenen Arten der Zungenwerke, sowohl,
die mit steif elastischen als die mit membranösen elastischen Zungen
untersucht worden, ist hier der Ort, auf die Theorie der
durch Zungen hervorgebrachten Töne zurückzukommen. Es handelt
sich hier jedoch nicht um die Schwingungen 'der Luft in
dem Ansatzrohr', sondern um die an der einfachen Zunge selbst.
Da in neuerer Zeit die durch blosse PulsUS von Flüssigkeiten
auf der Sirene, oder durch schnell folgende Stösse eines
festen Körpers, wie durch die Stösse der Zähne eines Rades hervorgebrachten
Töne bekannt geworden, hat man sich zu der Ansicht
geneigt, dass auch die Töne der Zungen durch Stösse der
Luft entstehen, indem die Zunge den Austritt der Luft aus dem
Rahmen der Zunge bei jeder Schwingung unterbricht. Der Umstand,
dass die durch Anstoss oder Zerrung an Zungen ohne
Blasen erregten Töne klanglos sind, scheint diese Ansicht zu
rechtfertigen, indess ist diese Theorie keineswegs erwieseu und
mehrere Gründe sprechen entschieden dagegen. Die Erörterung
dieses Gegenstandes ist für die Theorie der menschlichen Stimme
von grosser Wichtigkeit, es fragt sich nämlich hier zumal', was
beim Tonangeben der Stimme primitiv tönt, die Bänder der
Stimmritze oder die Luft.
W. W eber, dessen classischen Untersuchungen wir eine sichere
Kenntniss der Wirkungen in den Zungenpfeifen verdanken
, spricht sich bestimmt für jene Ansicht aus. P oggend. Arm.
XVI. 421. Er sagt: Der volle und starke Ton einer isolirt in
ihrem Rahmen ohne Ansatz schwingenden metallenen Platte beim
Blasen kann nicht von der schwingenden Platte hervorgebracht
seyn; denn in diesem Fall würde es nicht nöthig gewesen seyn,
den Ton der Platte durch einen Luftström zu erregen, sondern
sie würde einen in Hinsicht der Höhe und des Klanges ganz
gleichen Ton gegeben haben, wenn sie, ohne in ihrer Lage und
Verbindung geändert zu werden, auf irgend eine andere Weise
in Schwingung gesetzt wird, was aber nicht der Fall ist. Denn
W eber hat die Platte, während sie mit den übrigen Theilen des
Instrumentes verbunden blieb, durch Streichen mit dem Violinbogen1'
in die! heftigste Schwingung gesetzt, ohne im Stande zu
seyn einen mit jenem vollen und starken irgend vergleichbaren
Ton hervorzubringeh; indess 'finde ich den Ton einer Maultrommel
am Munde beim Anschlägen und beim Einziehen der
Luft glöidh. Jener Beweis scheint mir nicht entscheidend, und
tnir scheinen jedenfalls bei den membranösen Zungen, die Unter-
breeliuim des Luftstroms oder die Stösse nur einen untergeordneten
Einfluss bei dem Tongeben zu haben' und nur den Ton
mehr zu verstärken und_ voller zu machen als ihn zu bilden.
Ich halte die 'Erklärung der Zungentöne der membranösen
Zungen aus puhus der ’Luft für unwahrscheinlich aus folgenden
Gründen. \
1. Es ist kein : Grund vorhanden, die Töne der einfachen
Zungen von den Ünterbrcchungen des Luftstroms abzuleiten , da
die Tönis, welche! die Zuhgen selbst bei ihren Schwingungen angeben
mÜSsen, allein zur Erklärung der Zungentöne hinreichen. Es
ist zwar bemerkt, dass die Tone der membranösen Zungen, welche
durch Anstoss bewirkt werden, klanglos sind, und sich auch im
Timbre von den Zungentönen unterscheiden. Der erste Unterschied
lässt:sich aber hinreichend daraus erklären, dass der blosse einmalige
Anstoss nicht zur Unterhaltung der Schwingungen hinreicht.
Was den Unterschied des TimbreV anbelangt, so ist dieser zwar
nicht zu läugöen. Indessen geben auch andere Instrumente Töne
von verschiedenem Timbre, wenn sie in dem einen Fall durch
einmaligen Anstoss, im zweiten Fall durch fortdauernde Stösse
an-resprochen werden. Der Ton einer Saite ist z. B. im Klang
verschieden, wenn sie durch Zerrung einmal oder durch Streichen
mit dem Fidelbogen angeregt wird, und so unterscheiden
sich auch die Zungentönö,' wenn der Anstoss momentan oder
dauernd ist. Manche Membranen geben zwar durch Anstoss gar
keine Töne', wie die Lippen, der Spliincter ani und geben beim
Anblasen starke Zungentöne. Es kömmt jedoch für Entstehung
eines Tons nur auf die erforderliche Anzahl der Bebungen an;
und aus jener Erfahrung folgt nur, dass die regelmässige Folge
der Bebungeü an solchen Membranen bloss möglich ist, wenn
solche schlaffe Membranen beim Stossen durch die Luft auch
zugleich einigermassen ausgespannt erhalten werden, was beim
blossen Anstoss sogleich wegfällt.
2. Die von mir auf den dünnen metallischen und noch besser
auf membranösen Zungen ohne Rahmen durch Anblasen mit
einem feinen Röhrchen erzeugten Töne lassen sich nicht durch
Unterbrechungen des Luftstroms allein ei klären, sind aber im
Timbre «anz mit den Tönen dieser metallischen und mernbranö-
sen Zungen übereinstimmend, wenn sie in einem Rahmen als
wirkliche0 Zungen schwingen. Es Hesse sich zwar hier anführen,
dass auch der Luftstrom aus dem feinen Röhrchen bei den Rückschwingungen
der Zunge einigermassen gehindert werde. Aber
diess kann man schwerlich eine Unterbrechung nennen, da der
Luftstrom in dem Maass in anderer Richtung abgeht, als die