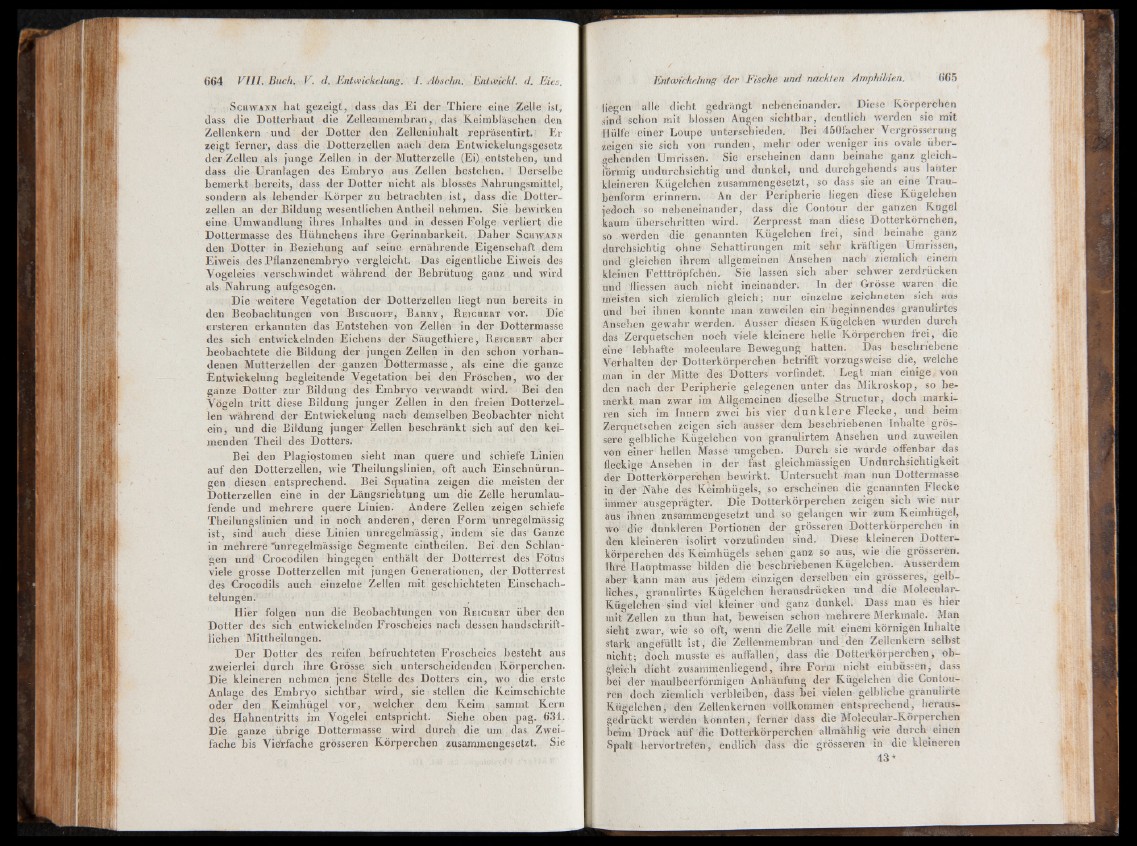
Schwann hat gezeigt, dass das,Ei der Thiere eine Zeile ist,
dass die Dotterhaut die Zellenmembran,. das Keimbläschen den
Zellenkern -und der Dotter den Zelleninhalt repräsentirt. Er
zeigt ferner, dass die Dotterzellen nach dem Entwickelungsgesetz
der Zellen als junge Zellen in der Mutterzelle (Ei). entstehen, und
dass die Uranlagen des Embryo aus Zellen bestehen. : Derselbe
bemerkt bereits, dass der Dotter nicht als blosses Nahrungsmittel,
sondern als lebender Körper zu betrachten ist, dass die Dotterzellen
an der Bildung wesentlichen Antheil nehmen. Sie bewirken
eine Umwandlung ihres Inhaltes und in dessen Folge verliert die
Dottermasse des Hühnchens ihre Gerinnbarkeit. Daher Schwann
den Dotter in Beziehung auf seine ernährende Eigenschaft dem
Eiweis des Pflanzenembryo vergleicht. Das eigentliche Eiweis des
Vogeleies verschwindet während der Bebrütung ganz und wird
als Nahrung aufgesogen.
Die weitere Vegetation der Dotterzellen liegt nun bereits in
den Beobachtungen von Bischoff, Barry, Beichert vor. Die
ersteren erkannten das Entstehen von Zellen in der Dottermasse
des sich entwickelnden Eichens der Säugethiere, Reichert aber
beobachtete die Bildung der jungen Zellen in den schon vorhandenen
Mutterzellen der ganzen Dottermasse, als eine die ganze
Entwickelung begleitende Vegetation bei den Fröschen, wo der
ganze Dotter zur Bildung des Embryo verwandt wird. Bei den
Vögeln tritt diese Bildung junger Zellen in den freien Dotterzellen
während der Entwickelung nach demselben Beobachter nicht
ein, und die Bildung junger Zellen beschränkt sich auf den keimenden
Theil des Dotters.
Bei den Plagiqstomen sieht man quere und Schiefe Linien
auf den Dotterzellen, wie Theilungslinien, oft auch Einschnürungen
diesen entsprechend. Bei Squatina zeigen die meisten der
Dotterzellen eine in der Längsrichtung um die Zelle herumlaufende
und mehrere quere Linien. Andere Zellen zeigen schiefe
Theilungslinien und in noch anderen, deren Form unregelmässig
ist, sind auch diese Linien unregelmässig, indem sie das-Ganze
in mehrere "unregelmässige Segmente eintheilen. Bei den Schlangen
und Crocodilen hingegen enthält der Dotterrest des Fötus
viele grosse Dotterzellen mit jungen Generationen, der Dotterrest
des Crocodils auch einzelne Zellen mit geschichteten Einschachtelungen.
-
Hier folgen nun die Beobachtungen von Reichert über den
Dotter des sich entwickelnden Froscheies nach dessen handschriftlichen
Mittheilungen.
Der Dotter des reifen befruchteten Froscheies besteht aus
zweierlei durch ihre Grösse sich unterscheidenden Körperchen.
Die kleineren nehmen jene Stelle des Dotters ein, wo die erste
Anlage des Embryo sichtbar wird, sie stellen die Keimschichte
oder den Keimhügel vor, welcher dem Keim sammt Kern
des Hahnentritts im Vogelei entspricht. Siehe oben pag. 631.
Die ganze übrige Dottermasse wird durch die um das Zweifache
bis Vielfache grösseren Körperchen zusammengesetzt. Sie
665
liegen alle dicht gedrängt nebeneinander. Diese Körperchen
sind schon mit blossen Augen sichtbar, deutlich werden sie mit
Hülfe einer Loupe unterschieden. Bei 450facher Vergrösserung
zeigen sie sich von runden, mehr oder weniger ins ovale übersehenden
Umrissen. Sie erscheinen dann beinahe ganz gleichförmig
undurchsichtig und dunkel, und durchgehends aus lauter
kleineren Kügelchen zusammengesetzt, so dass sie an eine Traubenform
erinnern. An der Peripherie liegen diese Kügelchen
jedoch so nebeneinander, dass die Contour der ganzen Kugel
kaum überschritten wird. Zerpresst man diese Dotterkörnchen,
so werden die genannten Kügelchen frei, sind beinahe ganz
durchsichtig ohne Schattirungen mit sehr kräftigen Umrissen,
und gleichen ihrem allgemeinen Ansehen nach ziemlich einem
kleinen Fetttröpfchen. Sie lassen sich aber schwer zerdrücken
und fliessen auch nicht ineinander. In der Grösse waren die
meisten sich ziemlich gleich; nur einzelne zeichneten sich aus
und bei ihnen konnte man zuweilen ein beginnendes granuiirtes
Ansehen gewahr werden. Ausser diesen Kügelchen wurden durch
das Zerquetschen noch viele kleinere helle Körperchen frei, die
eine lebhafte moleculare Bewegung hatten. Das beschriebene
Verhalten der Dotterkörperchen betrifft vorzugsweise die, welche
man in der Mitte des Dotters vorfindet. Legt man einige von
den nach der Peripherie gelegenen unter das Mikroskop, so bemerkt
man zwar im Allgemeinen dieselbe Structur, doch marki-
ren sich im Innern zwei bis vier d u n k le re Flecke, und beim
Zerquetschen zeigen sich ausser dem beschriebenen Inhalte grössere
gelbliche Kügelchen von granulirtem Ansehen und zuweilen
von einer hellen Masse umgeben. Durch sie wurde offenbar das
fleckige Ansehen in der fast gleichmässigen Undurchsichtigkeit
der Dotterkörperchen bewirkt. Untersucht man nun Dottermasse
in der Nähe des Keimhügels, So erscheinen die genannten Flecke
immer ausgeprägter. Die Dotterkörperchen zeigen sich wie nur
aus ihnen zusammengesetzt und so gelangen wir zum Keimhügel,
WO die dunkleren Portionen der grösseren Dotterkörperchen in
den kleineren isolirt vorzufinden sind. Diese kleineren Dotterkörperchen
des Keimhügels sehen ganz so ans, wie die grösseren.
Ihre Hauptmasse bilden die beschriebenen Kügelchen. Ausserdem
aber kann man aus ]edem einzigen derselben ein grösseres, gelbliches,
granuiirtes Kügelchen heransdriieken und die Molecular-
Kügelcheli sind viel kleiner und ganz dunkel. Dass man es hier
mit Zellen zu thun hat, beweisen schon mehrere Merkmale. Man
sieht zwar, wie so oft, wenn die Zelle mit einem körnigen Inhalte
stark angefüllt ist, die Zellenmembran und den Zellenkern selbst
nicht; doch musste es auffallen, dass die Dotterkörperchen, obgleich
dicht zusammenliegend, ihre Form nicht einbüssCn, dass
bei der maulbeerförmigen Anhäufung der Kügelchen die Contou-
ren doch ziemlich verbleiben, dass bei vielen gelbliche granulirte
Kügelchen, den Zellenkernen vollkommen entsprechend, herans-
gedrückt werden konnten, ferner dass die Molecular-Körperchen
beim Drück aitf die Dotterkörperchen allmählig wie durch einen
Spalt hervortreten, endlich daSs die grösseren in die kleineren