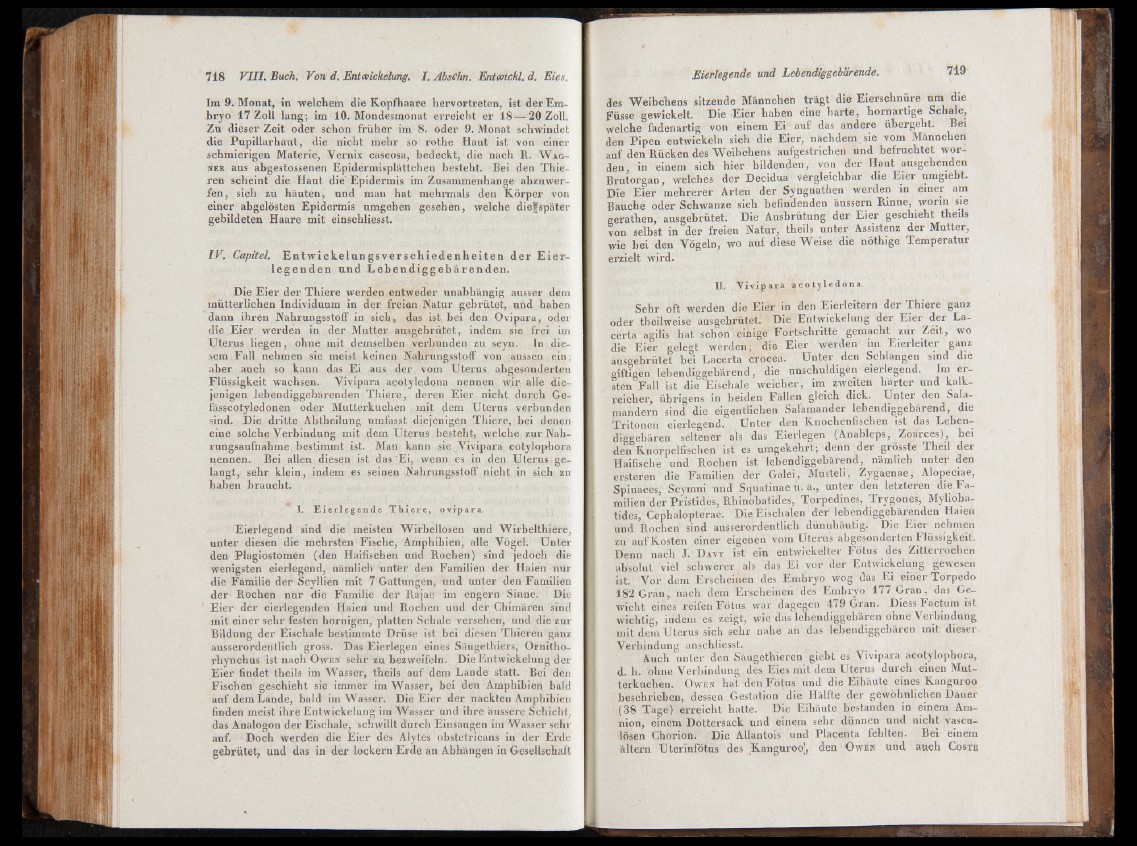
Im 9. Monat, in welchem die Kopfhaare hervortreten, ist der Embryo
17 Zoll lang; im 10. Mondesmonat erreicht er 18 — 20 Zoll.
Zn dieser Zeit oder schon früher im 8. oder 9. Monat schwindet
die Pupiüarhaot, die nicht mehr so rothe Haut ist von einer
schmierigen Materie, Vernix caseosa, bedeckt, die nach R. W agner
ans abgestossenen Epidermisplättchen besteht. Bei den Thie-
ren scheint die Hant die Epidermis im Zusammenhänge abzuwerfen,
sich zu häuten, und man hat mehrmals den Körper von
einer abgelösten Epidermis umgeben gesehen, welche diefspäter
gebildeten Haare mit einschliesst.
IV. Capitel. E n tw ic k e lu n g sv e rs c h ie d e n h e ite n d er E ie rle
g e n d e n und L e b e n d ig g e b ä re n d e n .
Die Eier der Thiere werden entweder unabhängig ausser dem
mütterlichen Individuum in der freien Natur gebrütet, und haben
dann ihren NahrungsstofF in sich, das ist bei den Ovipara, oder
die Eier werden in der Mutter ausgebrütet, indem sie frei im
Uterus liegen, ohne mit demselben verbunden zu seyn. In diesem
Fall nehmen sie meist keinen NahrungsstofF von aussen ein;
aber auch so kann das Ei aus der, vom Uterus abgesonderten
Flüssigkeit wachsen. Vivipara acotyledona nennen wir alle diejenigen
lebendiggebärenden Thiere, deren Eier nicht durch Ge-
fässcotyledonen oder Mutterkuchen mit dem Uterus verbunden
sind. Die dritte Abtheilung umfasst diejenigen Thiere, bei denen
eine solche Verbindung mit dem Uterus besteht, welche, zur Nahrungsaufnahme
bestimmt ist. Man kann sie Vivipara. cotylophora
nennen. Bei allen diesen ist das Ei, wenn es in den Uterus gelangt,
sehr klein, indem es seinen NahrungsstofF nicht in sich zu
haben braucht.
I. Eierlegende Thiere, ovipara.
Eierlegend sind die meisten Wirbellosen und Wirbelthiere,
unter diesen die mehrsten Fische, Amphibien, alle Vögel. Unter
den Plagiostomen (den Haifischen und Rochen) sind jedoch die
wenigsten eierlegend, nämlich unter den Familien der Haien nur
die Familie der Scyllien mit 7 Gattungen, und unter den Familien
der- Rochen nur die Familie der Rajae im Cngern Sinne. Die
Eier der eierlegenden Haien und Rochen und der Chimären sind
mit einer sehr festen hornigen, platten Schale versehen, und die zur
Bildung der Eischale bestimmte Drüse-ist bei diesen Thieren ganz
ausserordentlich gross. Das Eierlegen eines Säugethiers, Ornitho-
rhynchus ist nach Owen sehr zu bezweifeln. Die Entwickelung der
Eier findet theils im Wasser, theils auf dem Lande statt. Bei den
Fischen geschieht sie immer im Wasser, bei den Amphibien bald
auf dem Lande, bald im Wasser. Die Eier der nackten Amphibien
finden meist ihre Entwickelung im Wasser und ihre äussere Schicht,
das Analogon der Eischale, schwillt durch Einsaugen im Wasser sehr
auf. Doch werden die Eier des Alytes obstetricans in der Erde
gebrütet, und das in der lockern Erde an Abhängen in Gesellschaft
des Weibchens sitzende Männchen trägt die Eierschnüre um die
Füsse gewickelt. Die Eier haben eine harte, hornartige Schale,
welche fadenartig von einem Ei auf das andere übergeht. Bei
den Pipen entwickeln sich die Eier, nachdem, sie vom Männchen
auf den Rücken des Weibchens aufgestrichen und befruchtet worden,
in einem sich hier bildenden, von der Haut ausgehenden
Brutorgan, welches der Decidua vergleichbar die Eier umgiebt.
Die Eier mehrerer Arten der Syngnathen werden in einer am
Bauche oder Schwänze sich befindenden äussern Rinne, worin sie
gerathen, ausgebrütet. Die Ausbrütung der Eier geschieht theils
von selbst in der freien Natur, theils unter Assistenz der Mutter,
wie bei den Vögeln, wo auf diese Weise die nöthige Temperatur
erzielt wird.
II. " V i v i p a r a a c o t y l e d o n a .
Sehr oft werden die Eier in den Eierleitern der Thiere ganz
oder theilweise ausgebrütet. Die Entwickelung der Eier der La-
certa agilis hat schon einige Fortschritte gemacht zur Zeit, wo
die Eier gelegt werden; die Eier werden im Eierleiter ganz
ausgebrütet bei Lacerta crocea. Unter den Schlangen sind die
giftigen lebendiggebärend, die unschuldigen eierlegend. Im ersten
Fall ist die Eischale weicher, im zweiten härter und kalkreicher,
übrigens in beiden Fällen gleich dick. Unter den Salamandern
sind die eigentlichen Salamander lebendiggebärend, die
Tritonen eierlegend. Unter den Knochenfischen ist das Lebendiggebären
seltener als das Eierlegen (Anableps, Zoarces), bei
den Knorpelfischen ist es umgekehrt; denn der grösste Theil der
Haifische und Rochen ist lebendiggebärend, nämlich unter den
ersteren die Familien der Galei, Musteli, Zygaenae, Alopeciae,
Spinaces, Scymni und Squatinae u. a., unter den letzteren die Familien
der Pristides, Rhinobatides, Torpedines, Trygones, Mylioba-
tides, Cephalopterae. Die Eischalen der lebendiggebärenden Haien
und Rochen sind ausserordentlich dünnhäutig. Die Eier nehmen
zu auf Kosten einer eigenen vom Uterus abgesonderten Flüssigkeit.
Denn nach J. D avy ist ein entwickelter Fötus des Zitterrochen
absolut viel schwerer als das Ei vor der Entwickelung geivesen
ist. Vor dem Erscheinen des Embryo wog das Ei einer Torpedo
182 Gran, nach dem Erscheinen des Embryo 177 Gran, das Gewicht
eines reifen Fötus war dagegen 479 Gran. Diess Factum ist
wichtig, indem es zeigt, wie das lebendiggebären ohne Verbindung
mit dem Uterus sich sehr nahe an das lebendiggebären mit dieser
Verbindung anschliesst.
Auch unter den Säugethieren giebt es Vivipara acotylophora,
d. h. ohne Verbindung des Eies mit dem Uterus durch einen Mutterkuchen.
Owen hat den Fötus und die Eihäute eines Kanguroo
beschrieben, dessen Gestation die Hälfte der gewöhnlichen Dauer
(38 Tage) erreicht hatte. Die Eihäute bestanden in einem Amnion,
einem Dottersack und einem sehr dünnen und nicht vascu-
lösen Chorion. Die Allantois und Placenta fehlten. Bei einem
altern Uterinfötus des Kanguroo), den Owen und auch Coste