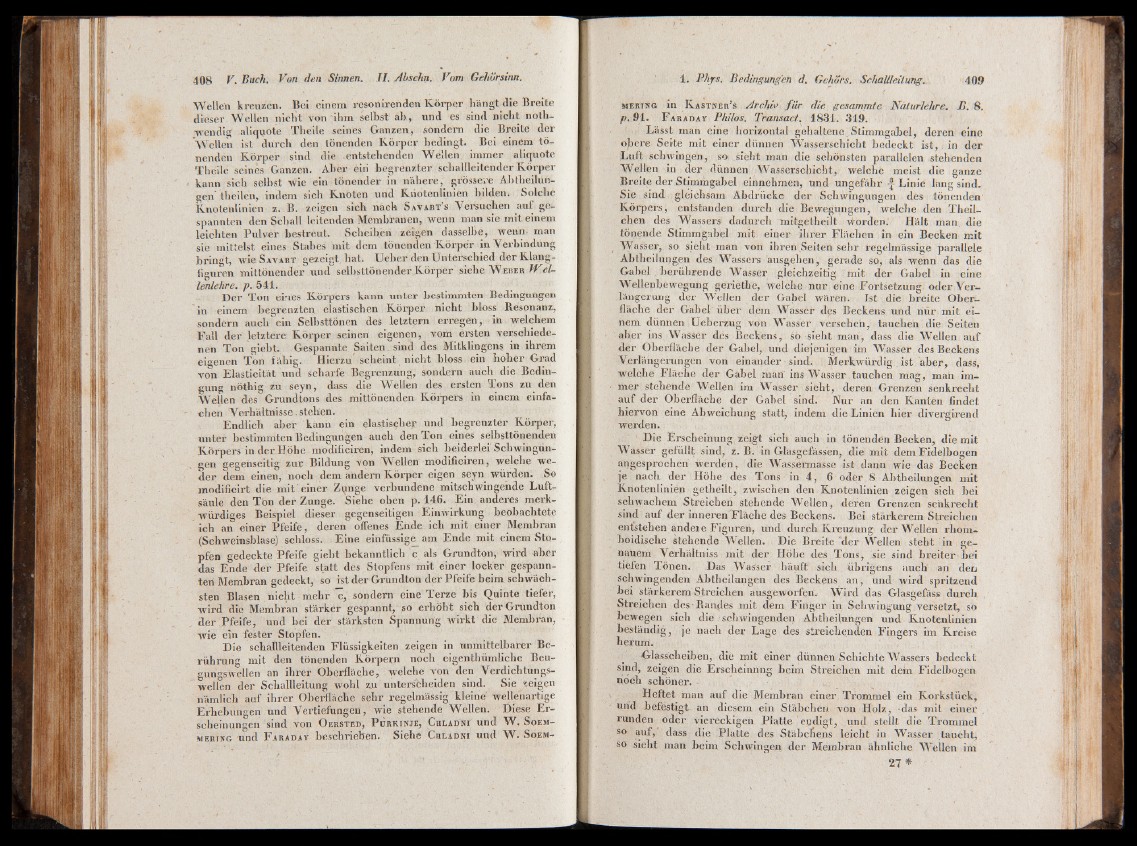
Wellen kreuzen. Bei einem resonirenden Körper liängt die Breite
dieser Wellen nicht von "ihm selbst ah, und es sind nicht notli-
wendig aliquote Theile seines Ganzen, Sondern die Breite der
Wellen ist durch den tönenden Körper Bedingt. Bei einem tönenden
Körper sind die .entstehenden Wellen immer aliquote
Theile seines Ganzen. Aber ein begrenzter schallleitender Körper
kann sieh seihst wie ein tönender in nähere, grössere Abteilungen
theilen, indem sich Knoten und Knotenlinien bilden. Solche
Knotenlinien z. B. zeigen sich nach S avarts ."Versuchen auf gespannten
den Schall leitenden Membranen, wenn man sie mit einem
leichten Pulver bestreut. Scheiben zeigen dasselbe, wenn man
sie mittelst eines Stahes mit dem tönenden Körper in Verbindung
bringt, wieSAVABT gezeigt hat. Ueber den Unterschied der Klangfiguren
mittönender und selbsttönender Körper siehe W eber Wellenlehre.
p. 541.
Der Ton eines Körpers kann unter bestimmten Bedingungen
in einem begrenzten elastischen Körper nicht bloss Resonanz,
sondern auch ein Selbsttönen des letztem erregen, ■ in , welchem
Fall der letztere Körper seinen eigenen, vom ersten verschiedenen
Ton giebt. Gespannte Saiten , sind des Mitklingen? in ihrem
eigenen Ton f ähig. Hierzu scheint nicht bloss ein hoher Grad
von Elasticität und scharfe Begrenzung, sondern auch die Bedingung
nöthig zu seyn, dass die Wellen des ersten Tons zu den
Wellen des Grundtons des mittönenden Körpers in einem einfachen
Verhältnisse - stehen.
Endlich aber kann ein elastischer und begrenzter Körper,
unter bestimmten Bedingungen auch den Ton eines selbsttönenden
Körpers in derHöbe modificiren, indem sich beiderlei Schwingungen
gegenseitig zun Bildung von Wellen modificiren, welche weder
dem einen, noch dem andern Körper eigen seyn würden. So
modificirt die mit einer Zqnge verbundene mitschwingehde Luftsäule
den T'on der Zunge. Siehe oben p. 146. Ein anderes merkwürdiges
Beispiel dieser gegenseitigen Einwirkung beobachtete
ich an einer Pfeife, deren offenes Ende ich mit einer Membran
(Schweinsblase) schloss. Eine einfüssige_ am Ende mit einem Stopfen
gedeckte Pfeife gieht bekanntlich c als Grundton, wird aber
das Ende der Pfeife statt des Stopfens mit einer locker gespannten
Membran gedeckt, so ist der Grandton der Pfeife beim schwächsten
Blasen nicht mehr c, sondern eine Terze bis Quinte tiefer,
wird die Membran stärker gespannt, so erhöht sich der Grundton
der Pfeife, und bei der stärksten Spannung wirkt die Membran,
wie ein fester Stopfen.
Die schallleitenden Flüssigkeiten zeigen in unmittelbarer Berührung
mit den tönenden Körpern noch eigentümliche Beugungswellen
an ihrer Oberfläche, welche von den Verdichtungswellen
der Schallleitung wohl zu unterscheiden sind. Sie zeigen
nämlich auf ihrer Oberfläche sehr regelmässig kleine" wellenartige
Erhebungen.und Vertiefungen, wie stehende Wellen. Diese Erscheinungen
sind von Oersted, P urkinje, Chladni' und W. Soem-
mering und F araday beschrieben. Siehe Cheadni und W. Soemmering
in K astner’s Archiv fü r die gesammte Naturlehre. B. 8.
p. 91. F araday Philos. Transact. 1831. 319.
Lässt man eine horizontal gehaltene.Stimmgabel, deren eine
obere Seite mit einer dünnen Wasserschicht bedeckt ist, in der
Luft schwingen, so sieht man die schönsten parallelen stehenden
Wellen in der dünnen Wasserschicht, welche meist die ganze
Breite der Stimmgabel einnehmen, und ungefähr ^ Linie lang sind.
Sie sind gleichsam Abdrücke der Schwingungen des tönenden'
Körpers, entstanden dureh die Bewegungen, welche den Tbeil-
chen des Wassers dadurch mitgetheilt Worden. Hält man die
tönende Stimmgabel mit einer ihrer Flächen in ein Becken mit
Wasser, so sieht man von ihren Seiten sehr regelmässige parallele
Abtheilungen des Wassers ausgehen, gerade so, als wenn das die
Gabel berührende Wasser gleichzeitig mit der Gabel in eine.
Wellenbewegung gerièthe, welche nur eine Fortsetzung oder Verlängerung
der Wellen der Gabel wären. Ist die breite Oberfläche
der Gabel über dem Wasser dps Beckens und nür mit einem
dünnen Ueberzug von Wasser versehen, tauchen die Seiten
aber ins Wasser des Beckens, so sieht man, dass die Wellen auf
der Oberfläche der Gabel, und diejenigen im Wasser des Beckens
Verlängerungen von einander sind. Merkwürdig ist aber, dass,
welche Fläche der Gabel man ins Wasser, tauchen mag, man immer;
stehende Wellen im Wasser sieht, deren Grenzen senkrecht
auf der Oberfläche der Gabel sind; Nur an den Kanten findet
hiervon eine Abweichung statt, indem die Linien hier divergirend
werden.
■ Die Erscheinung zeigt sich auch in tönenden Becken, die mit
Wasser gefüllt sind, z. B. in Glasgefässen, die mit dem Fidelbogen
angesprochen werdén, die V'assermas.se ist dann wie das Becken
je nach der Höhe des Tons in 4, 6 oder 8 Abtheilungen mit
Knotenlinien getheilt, zwischen den Knotenlinien zeigen sich bei
schwachem Streichen stehende Wellen, deren Grenzen senkrecht
sind auf der inneren Fläche des Beckens. Bei stärkeremStreichen
entstehen andeie Figuren, und durch Kreuzung der Wellen rhom-
boidische stehende Wellen. Die Breite'der Wellen steht in genauem
Verhältniss mit der Höhe des Tons, sie sind breiter bei
tiefen Tonen. Das Wasser häuft sich übrigens auch an den
schwingenden Abtheilungen des Beckens an, und wird spritzend
bei stärkerem Streichen ausgeworfen. Wird das Glasgefäss durch
Streichen des-Randes mit dem Finger in Schwingung; versetzt, so
bewegen sich die schwingenden Abtheilungen und Knotenlinien
beständig, je nach der Lage des streichenden Fingers im Kreise
herum.
•Glasscheiben, die mit einer dünnen Schichtè Wassers bedeckt
sind, zeigen die Erscheinnng beim Streichen mit dem Fidelbogen
noch schöner. ■
Heftet man auf die Membran einer Trommel ein Korkstück,
und befestigt an diesem ein Stäbchen von Holz, -das mit einer
runden oder viereckigen Platte endigt, und stellt die Trommel
so auf, dass die Platte des Stäbchens leicht in Wasser taucht,
sö sieht man beim Schwingen der Membran ähnliche Wellen im