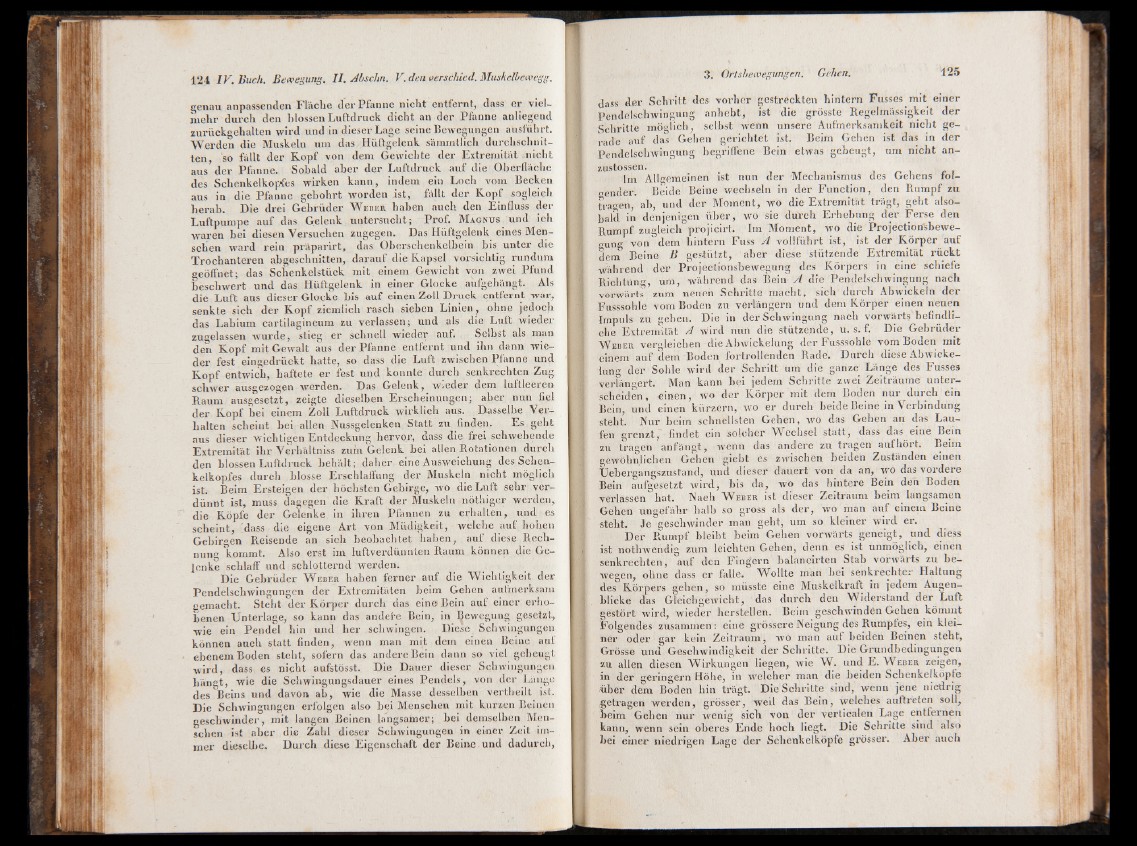
eenau anpassenden Fläche der Pfanne nicht entfernt, dass er vielmehr
durch den hlossen Luftdruck dicht an der Pfanne anliegend
zurückgehalten wird und in dieser Lage seine Bewegungen ausführt.
Werden die Muskeln um das Hüftgelenk sämmtlich durchschnitten
so fällt der Kopf von dem Gewichte der Extremität nicht
a u sse r Pfanne. Sobald aber der Luftdruck auf die Oberfläche
des Schenkelkop*fes wirken kann, indem ein Loch vom Becken
aus in die Pfanne gebohrt worden ist, fällt der Kopf sogleich
herab. Die drei Gebrüder W eder haben auch den Einfluss der
Luftpumpe auf das Gelenk untersucht; Prof. Magnus und ich
waren bei diesen Versuchen zugegen. Das Hüftgelenk eines Menschen
ward rein präparirt, das Oberschenkelbein bis unter die
Trochanteren abgeschnitten, darauf die Kapsel vorsichtig rundum
geöffnet; das Schenkelstück mit einem Gewicht von zwei Pfund
beschwert und das Hüftgelenk in einer Glocke aufgehängt. Als
die Luft aus dieser Glocke bis auf einen Zoll Druck entfernt war,
senkte sich der Kopf ziemlich rasch sieben Linien, ohne jedoch
das Labium cartilagineum zu verlassen; und als die Luft wieder
zugelassen wurde, stieg er schnell wieder auf. Selbst als man
den Kopf mit Gewalt aus der Pfanne entfernt und ihn dann wieder
fest eingedrückt hatte, so dass die Luft zwischen Pfanne und
Kopf entwich, haftete er fest und konnte durch senkrechten Zug
schwer ausgezogen werden. Das Gelenk, wieder dem luftleeren
Raum ausgesetzt, zeigte dieselben Erscheinungen; aber nun fiel
der Kopf bei einem Zoll Luftdruck wirklich aus. Dasselbe Verhalten
scheint bei allen Nussgelenken Statt zu finden. Es geht
aus dieser wichtigen Entdeckung hervor, dass die frei schwebende
Extremität ihr Verhältniss zum Gelenk bei allen Rotationen durch
den blossen Luftdruck behält; daher eine Ausweichung des Schenkelkopfes
durch blosse Erschlaffung der Muskeln nicht möglich
ist. Beim Ersteigen der höchsten Gebirge, wo die Luft sehr verdünnt
ist, muss dagegen die Kraft der Muskeln nöthiger werden,
die Köpfe der Gelenke in ihren Pfannen zu erhalten, und es
scheint, ;dass die eigene Art von Müdigkeit, welche auf hohen
Gebirgen Reisende an sich beobachtet haben, auf diese Rechnung
kommt. Also erst im luftverdünnten Raum können die Gelenke
schlaff und schlotternd werden.
Die Gebrüder W eber haben ferner auf die Wichtigkeit der
Pendelschwingungen der Extremitäten beim Gehen aufmerksam
cemacht. Steht der Körper durch das eine Bein auf einer erhobenen
Unterlage, so kann das andere Bein, in Bewegung gesetzt,
wie ein Pendel hin und her schwingen. Diese Schwingungen
können auch statt finden, wenn man mit dem einen Beine aut
ebenem Boden steht, sofern das andere Bein dann so viel gebeugt
wird, dass es night aufstösst. Die Dauer dieser Schwingungen
hängt, wie die Schwingungsdauer eines Pendels, von der Länge
des Beins und davon ab, wie die Masse desselben vertheilt ist.
Die Schwingungen erfolgen also bei Menschen mit kurzen Beinen
geschwinder, mit langen Beinen langsamer; bei demselben Menschen
ist aber die Zahl dieser Schwingungen in einer Zeit immer
dieselbe. Durch diese Eigenschaft der Beine und dadurch,
dass der Schritt des vorher gestreckten hintern Fusses mit einer
Pendelschwingung anhebt, ist die grösste Regelmässigkeit der
Schritte möglich, selbst wenn unsere Aufmerksamkeit nicht gerade
auf das Gehen gerichtet ist. Beim Gehen ist das in der
Pendelschwingung begriffene Bein etwas gebeugt, um nicht anlm
Allgemeinen ist nun der Mechanismus des Gehens folgender.
Beide Beine wechseln in der Function, den Rumpf zu
tragen, ab, und der Moment, wo die Extremität trägt, geht also-
bald in denjenigen über, wo sie durch Erhebung der Ferse den
Rumpf zugleich projicirt. Im Moment, wo die Projection'sbewe-
gung von dem hintern Fuss A vollführt ist, ist der Körper auf
dem Beine B gestützt, aber diese stützende Extremität rückt
während der Projectionsbevvegung des Körpers in eine schiefe
Richtung, um, während das Bein A die Pendelschwingung nach
vorwärts zum neuen Schritte macht, sich durch Ab wickeln der
Fusssohle vom Boden zu verlängern und dem Körper einen neuen
Impuls zu geben. Die in der Schwingung nach vorwärts befindliche
Extremität A wird nun die stützende, u. s. f. Die Gebrüder
W eder vergleichen die Abwickelung der Fusssohle vom Boden mit
einem auf dem Boden fortrollenden Rade. Durch diese Abwickelung
der Sohle wird der Schritt um die ganze Länge des Fusses
verlänoert. Man kann bei jedem Schritte zwei Zeiträume unterscheiden
, einen, wo der Körper mit dem Loden nur durch ein
Bein, und einen kürzern, wo er durch beide Beine in Verbindung
steht. Nur beim schnellsten Gehen, -wo das Gehen an das Laufen
grenzt,’ findet ein solcher Wechsel statt, dass das eine Bein
zu tragen anfängt, wenn das andere zu tragen auf hört. Beim
gewöhnlichen Gehen giebt es zwischen beiden Zuständen einen
Uebergangszustand, und dieser dauert von da an, wo das vordere
Bein aufgesetzt wird, bis da, wo das hintere Bein den Boden
verlassen hat. Nach "NVeber ist dieser Zeitraum beim langsamen
Gehen ungefähr halb so gross als der, wo man auf einem Beine
steht. Je geschwinder man geht, um so kleiner wird er.
Der Rumpf bleibt beim Gehen vorwärts geneigt, und diess
ist nothwendig zum leichten Gehen, denn es ist unmöglich, einen
senkrechten, auf den Fingern balancirten Stab vorwärts zu bewegen,
ohne dass er falle. Wbllte man bei senkrechter Haltung
des Körpers gehen, so müsste eine Muskelkraft in ]edem Augenblicke
das Gleichgewicht, das durch den Widerstand der Luft
gestört -wird, wieder hersteilen. Beim geschwinden Gehen kömmt
Folgendes zusammen: eine grössere Neigung des Rumpfes, ein kleiner
oder gar kein Zeitraum, wo man auf beiden Beinen steht,
Grösse und Geschwindigkeit der Schritte. Die Grundbedingungen
zu allen diesen Wirkungen liegen, wie W. und E. W eber zeigen,
in der geringem Höhe, in welcher man die beiden Schenkelköpte
über dem Boden hin trägt. Die Schritte sind, wenu jene niedrig
^getragen werden, grösser, weil das Bein, welches auftreten soll,
beim Gehen nur wenig sich von der verticalen Lage entfernen
kann, wenn sein oberes Ende hoch liegt. Die Schritte sind also
bei einer niedrigen Lage der Schenkelköpfe grösser. Aber auch