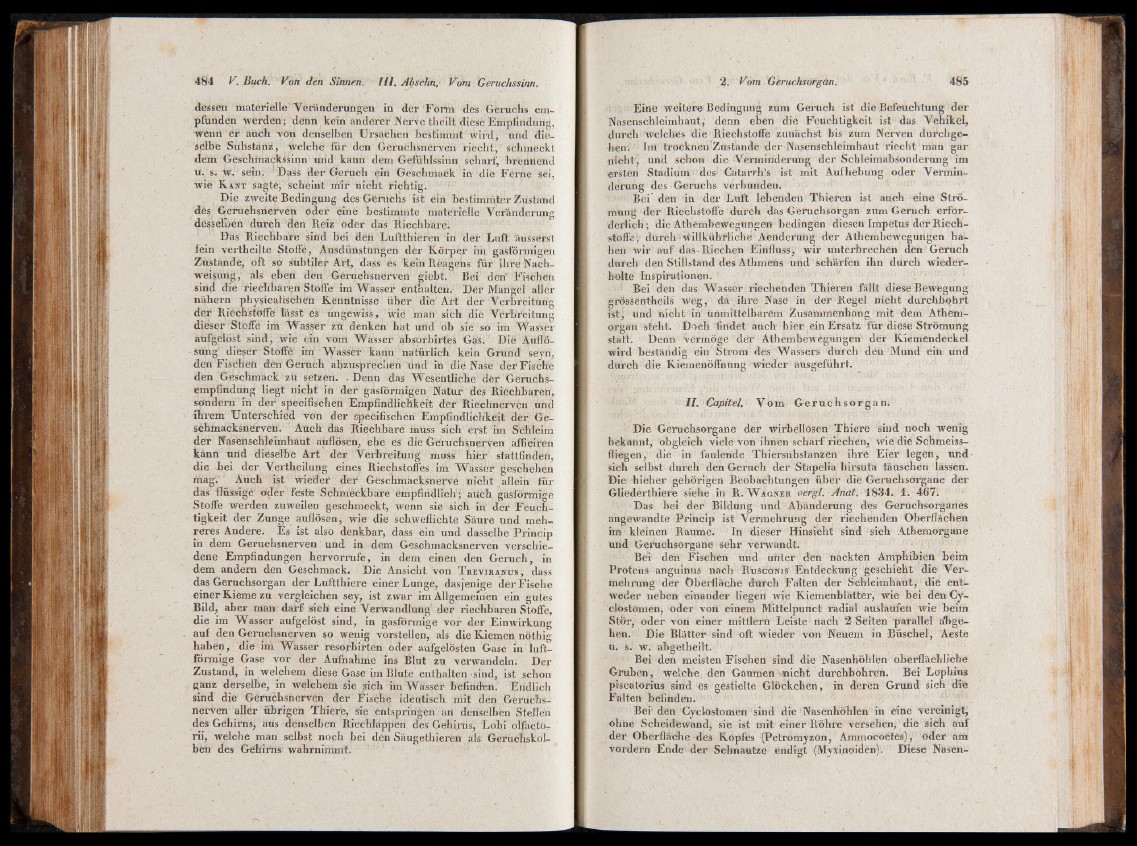
dessen materielle'Veränderungen in der Form des Geruchs empfunden
werden ; denn kein anderer •Nerve llieilt diese Empfindung,
wenn er auch von denselben Ursachen bestimmt wird, und dieselbe
Substanz, welche für den Geruchsnerven riecht, schmeckt
dem Geschmackssinn und kann dem Gefühlssinn scharf, brennend
u. s. w. sein. Dass der Geruch ein Geschmack in die Ferne sei,
wie K a n t sagte, scheint mir nicht richtig/
Die zweite Bedingung des Geruchs ist ein bestimmter Zustand
des Geruchsnef-ven oder eine bestimmte materielle Veränderung
desselben durch den Reiz oder das Riechbare.
Dös Riechbare sind bei fleh Luftthieren in der Luft äusserst
fein vertheilte Stoffe, Ausdünstungen der Körper im gasförmigen
Zustande, oft so subtiler Art, dass es kein Réagens für ihre Nachweisung,
als eben dén Géruchsnerven giebt. Bei den* Fischen
sind die riechbaren Stoffe im Wasser enthalten.-' Dér Mangel aller
nähern pbysicalischen Kenntnisse über die Art der Verbreitung
der Riechstoffe lässt es ungewiss, wié man sieh die Verbreitung
dieser Stoffe im Wassér zü denken hat und ob sie so im Wassér
aufgélöst sind, wie ein vom Wasser absorbirtes Gas. Dié Auflösung'
dieser Stoffe im Wasser kann natürlich kein Grund seyn,
den Fischen den Geruch abzusprechen und in die Vase der Fische
den Geschmack zü setzen. - Denn das Wesentliche dér Geruchsempfindung
liegt nicht’ in der gasförmigen Natur des Riechbaren,
sondern in der' specifischen Empfindlichkeit der Riechnerven und
ihrem Unterschied von der specifischen Empfindlichkeit der Geschmacksnerven.
Auch das Riechbare muss sich erst im Schleim
der Nasenschleimhaut auflösen, ehe es die Géruchsnerven affieiren
känn urid dieselbe Art der Verbreitung muss hier slaftfinden,
die bei der Vertheilung eines Riechstoffes im Wasser geschehen
mag; Auch ist wieder der Géscbmàcksnervé nicht allein für
das flussigé' oder feste Schmeckbare empfindlich; atich gasförmige
Stoffe werden zuweilen geschmeckt, wenn sie Sich in der Feuchtigkeit
der Zunge auflösen, wie die schweflichte Same und meh-
reres Andere. Es ist also denkbar, dass ein und dasselbe Princip
in dem Geruchsnerven ' und in dem Geschmacksnerven verschiedene
Empfindungen hervorrufe, in dem einen den Geruch, in
dem andern den Geschmack. Die Ansicht von Treviranus, dass
das Geruchsorgan der Luftthiere einer Lunge, dasjenige der Fische
einer Kième zu vergleichen sey, ist zwar im Allgemeinen ein gutes
Bild, aber man darf sieh eine Verwandlung der riechbaren Stoffe,
die im Wässer aufgelöst sind, in gasförmige vor der Einwirkung
auf den Geruchsnerven so wenig vorstellen, als die Kiemen nöthig
haben, die ini Wasser rèsörbirten oder aufgelösten Gase in luft-
förmige Gase vor der Aufnahme ins Blut zu verwandeln. Der
Zustand, in welchem diese Gase im Blute enthalten-sind, ist schon
ganz derselbe, in welchem sie sich im Wasser befinden. Endlich
sind die Geruchsnerven der Fisóhe identisch riiit den Géruchsnerven
aller übrigen Tbiere, sie entspringen an denselben Steifen
des Gehirns, aus denselben Riechlappen des Gehirns, Lobi olfactö-
rii, welche man selbst noch bei den Säugethiereü als Geruchskol-
beh des Gehirns wahrnimmt.
Eine weitere Bedingung zum Geruch ist die Befeuchtung der
Nasenschleiinhaut, denn eben die Feuchtigkeit ist das Vehikel,
durch welches die Riechstoffe zunächst bis zum Nerven durchgehen'.
Im trocknen'Zustände der Nasenschleimhaut riecht man gar
nicht, und schon die Verminderung der Schleimabsonderung im
ersten Stadium- des Catarrh’s ist mit Aufhebung oder Verminderung
des Geruchs Verbunden.
Bei den in der Luft lebenden Thieren ist auch eine Strömung
der Riechstoffe durch das Géruchsorgan zürn Geruch erforderlich
; die Atbembewegungen bedingen diesen Impetus der Riechstoffe/
durch vtillkührliche AendeCUng der Athémbewegurtgen haben
wir auf das Riechen Einfluss, wie unterbrechen den Geruch
durch den Stillstand des Athmens und schärfen ihn durch wiederholte
Inspirationen. f Bei den das Wasser riechenden Thieren fällt dièse Bewegung
grösSentheils’ weg, da ihre Nase in dér Regel nicht dufchbqhrt
ist, Und nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Athem-
organ steht. Doch findet auch • hier ein Ersatz für diese Strömung,
statt. Denn vermöge dér Athembewègungen'' der Kiemendeckel
wird beständig ein Strom des Wassers durch deu Mund ein und
durch die Kiemenöffnung wieder ausgeführt.
II. Capitel. Vom G e ru ch so rg an .
Die Geruchsorgane der wirbellösen Thiere sind noch wenig
bekannt, obgleich viele von ihnen scharf riechén, wié die Schrneiss-
flfegeöy die ‘ in faulende Thiersubstanzen ihre’ Eier legen, und-
sich selbst durch den Geruch dér Stapelia hirsuta täuschen lassen.
Die- 'hieher gehörigen Beobachtungen über die Geruehsorgäne der
Gliederthiere siehe in R. W agner vergl. Anat. 1834. 4. 467.
Das bei der Bildung und Abänderung des Geruchsorganes
angewandte Princip ist Vermehrung der riechenden Oberflächen
im kleinen Raume. In dieser Hinsicht sind sich Athemorgäne
Uhd Geruchsorgane sehr verwandt.
Bei den Fischen und unter den nackten Amphibien beim
PröteUs anguittus nach R ü s c ö n iS Entdeckung geschieht die Vermehrung
der Oberfläche durch Falten der Schleimhaut dié entweder
neben einander liegen wie Kiemenblätter, wie bei den Cy-
elostoinen, oder von einem Mittelpunct radial auslaufen wie beim
Stör, oder von einer mittlern Leiste nach 2 Seiten parallel a'bgehen.
Die Blätter sind oft wieder von Neuem in Büschel, Aeste
u. s. w. abgetheilt.
Bei den meisten Fischen sind die Nasenhöhlen oberflächliche
Gruben, Welche den Gaumen nicht durchbohren. Bei Löphius
piscatörius sind es:gestielte Glöckchen, in deren Grund sich die
Falten befinden.
Bei den Gyclostomen sind die Nasenhöhlen in eine vereinigt,
ohhe Scheidewand, sie ist mit einer Röhre versehen, die sich auf
der Oberfläche-des Kopfes (Petromyzön, Ammocoetes), oder am
vordem Ende der Schnautze endigt (Myxinoiden). Diese Nasen