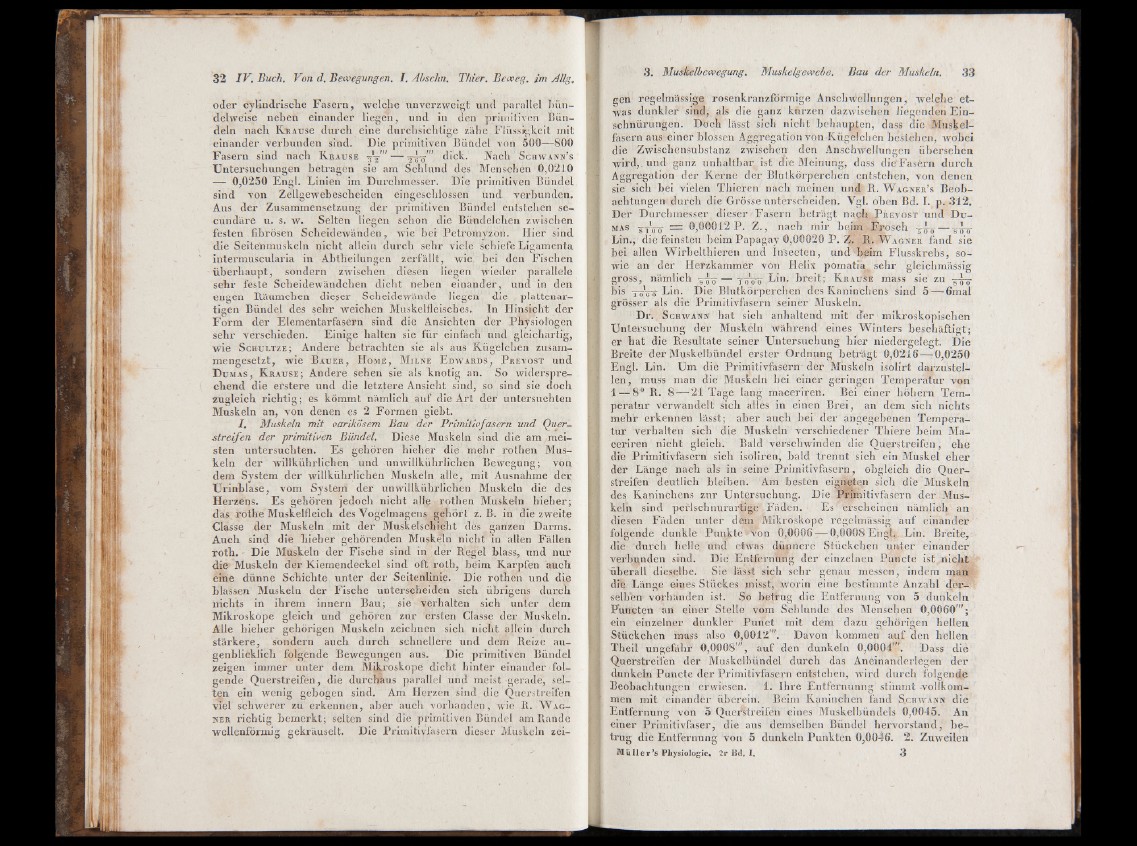
oder cylindrische Fasern, welche unverzweigt und parallel bündelweise
neben einander liegen, und in den primitiven Bündeln
nach Kruuse durch eine durchsichtige zähe Flüssigkeit mit
einander verbunden sind. Die primitiven Bündel von 500—800
Fasern sind nach K rause f f " — TsV” dick. Nach S chwann’s
Untersuchungen betragen sie am Schlund des Menschen 0,0210
— 0,0250 Engl. Linien im Durchmesser. Die primitiven Bündel
sind von Zellgewebescheiden eingeschlossen und verbunden.
Aus der Zusammensetzung der primitiven Bündel entstehen se-
cundäre u. s. w. Selten liegen schon die Bündelchen zwischen
festen fibrösen Scheidewänden, wie bei Petromyzon. Hier sind
die Seite'nmuskeln nicht allein durch sehr viele schiefe Ligamenta
intermuscularia in Abtheilungen zerfällt, wie bei den Fischen
überhaupt, sondern zwischen diesen liegen wieder parallele
sehr feste Scheidewändchen dicht neben einander, und in den
engen Räumchen dieser Scheidewände liegen die plaltenar-
tigen Bündel des sehr weichen Muskelfleisches.' In Hinsicht der
Form der Elementarfasern sind die Ansichten der Physiologen
sehr verschieden. Einige halten sie für einfach und gleichartig,
wie S chultze; Andere betrachten sie als aus Kügelchen zusammengesetzt,
wie Bauer, H ome, Milne E dwards, P révost und
D umas, K rause; Andere sehen sie als knotig an. So widersprechend
die erstere und die letztere Ansicht sind, so sind sie doch
zugleich richtig; es kömmt nämlich auf die Art der untersuchten
Muskeln an, von denen es 2 Formen giebt.
I. Muskeln mit varikösem Bau der Primitivfasern und Querstreifen
der primitiven Bündel. Diese Muskeln sind die am ..meisten
untersuchten. Es gehören hieher dié mehr rothen Muskeln
der willkührlichen und unwillkührlichen Bewegung;,, von
dem System der willkührlichen Muskeln alle, mit Ausnahme dep
Urinblase, vom System der unwillkührlichen Muskeln die des
Herzens. Es gehören jedoch nicht alle rothen Muskeln hieher;
das rothe Muskelfleich des Vogelmagens gehört z. B. in die zweite
Classe der Muskeln mit der Muskelschicht dés ganzen Darms.
Auch sind die hieher gehörenden Muskeln nicht in allen Fällen
Toth. ■ Die Muskeln der Fische sind in der Regel blass, und nur
die Muskeln der Kiemendeckel sind oft roth, beim Karpfen auch
eine dünne Schichte unter der Seitenlinie. Die rothen und die
blassen Muskeln der Fische unterscheiden sich übrigens durch
nichts in ihrem innern Bau; sie verhalten sich unter dem
Mikroskope gleich und gehören zur ersten Classe der Muskeln.
Alle hieher gehörigen Muskeln zeichnen sich nicht allein durch
stärkere, sondern auch durch schnellere und dem Reize augenblicklich
folgende Bewegungen aus. Die primitiven Bündel
zeigen immer unter dem Mikroskope dicht hinter einander folgende
Querstreifen, die durchaus parallel und meist gerade, selten
ein wenig gebogen sind. Am Herzen sind die Querstreifen
viel schwerer zu erkennen, aber auch vorhanden, wie R. W agner
richtig bemerkt; selten sind die primitiven Bündel am Rande
wellenförmig gekräuselt. Die Primitivfasern dieser Muskeln zeigen
regelmässige rosenkranzförmige Anschwellungen, welche etwas
dunkler sind, als die ganz kurzen dazwischen liegenden Einschnürungen.
Doch lässt sich nicht behaupten, dass die Muskelfasern
aus einer blossen Aggregation von Kiigélcben bestehen, wobei
die Zwischensubstanz zwischen den Anschwellungen übersehen
wird,, und ganz unhaltbar ist die Meinung, dass dieFasérn durch
Aggregation der Kerne der Blutkörperchen entstehen, von denen
sie sich bei vielen Tbieren nach meinen und R. W agner’s Beobachtungen
durch die Grösse unterscheiden. Vgl. oben Bd. I. p. 312.
Der Durchmesser dieser Fasern beträgt nach .P revost‘und D umas
■gyV'ö = 0,00012 P. Z., nach mir beim Frosch — s m
Lin., die feinsteu beim Papagay 0,00020 P. Z. R. W agner fand sie
bei allen Wirbelthieren und Insecten, und' beim Flusskrebs, sowie
an der Herzkammer von Helix pomatia sehr gleichmässig
gross, nämlich —töttö Ein. breit; Krause mass sie zu
bis YoVo Ein. Die Blutkörperchen des Kaninchens sipd 5 — 6mal
grösser als die Primitivfasern seiner Muskeln.
Dr. S chwann hat sich anhaltend mit der mikroskopischen
Untersuchung der Muskeln während eines Winters beschäftigt;
er hat die Resultate seiner Untersuchung hier niedergelegt. Die
Breite der Muskelbündel erster Ordnung beträgt 0,0216—r0,0250
Engl. Lin. Um die Primitivfasern der Muskeln isolirt darzustellen,
muss man die Muskeln bei einer geringen Temperatur von
1 — 8° R. 8 — 21 Tage lang maeeriren. Bei einer höhern Temperatur
verwandelt sich alles in einen Brei, an dem sich nichts
mehr erkennen lässt; aber auch bei der angegebenen Temperatur
verhalten sich die Muskeln verschiedener Tliiere beim Ma-
ceriren nicht gleich. Bald verschwinden die Querstreifen, ehe
die Primitivfasern sich isoliren, bald trennt sich ein Muskel eher
der Länge nach als in seine Primitivfasern, obgleich die Querstreifen
deutlich bleiben. Am besten eigneten sich die Muskeln
des Kaninchens zur Untersuchung. Die ' Prirriilivfasern der Muskeln
sind perlschnurartige/Fäden. • Es erscheinen nämlich an
diesen Fäden unter dem/Mikroskope regelmässig auf einander
folgende dunkle Punkte »'von 0,00060,0008 Engl. Lin. Breite,
die durch helle, und etwas dünnere Stückchen unter einander
verbunden sind. Die Entfernung der einzelnen Puncte ist nicht
überall dieselbe. Sie lässt sich sehr genau messen, indem man
die Länge eines Stückes misst, worin eine bestimmte Anzahl derselben
vorhanden ist. So betrug die Entfernung von 5 dunkein
Puncten an einer Stelle vom Schlunde des Menschen 0,0060'”;
ein einzelner dunkler Punct mit dem dazu gehörigen hellen
Stückchen mass also 0,0012 ”. Davon kommen auf den hellen
Theil ungefähr 0,0008'”, auf den dunkeln 0,0004”'. Dass die
Querstreifen der Muskelbündel durch das Aneinanderlegen der
dunkeln Puncte der Primitivfasern entstehen, wird durch folgende
Beobachtungen erwiesen. 1. Ihre Entfernunng stimmt -vollkommen
mit einander überein. Beim Kaninchen fand S.chwann die
Entfernung von 5 Quei^treifen eines Muskelbündels 0,0045. An
einer Primitivfaser, die aus demselben Bündel hervorstand, betrug
die Entfernung von 5 dunkeln Punkten 0,0046. 2. Zuweilen
M ü lle r’s Physiologie. 2r Bd, 1, 3