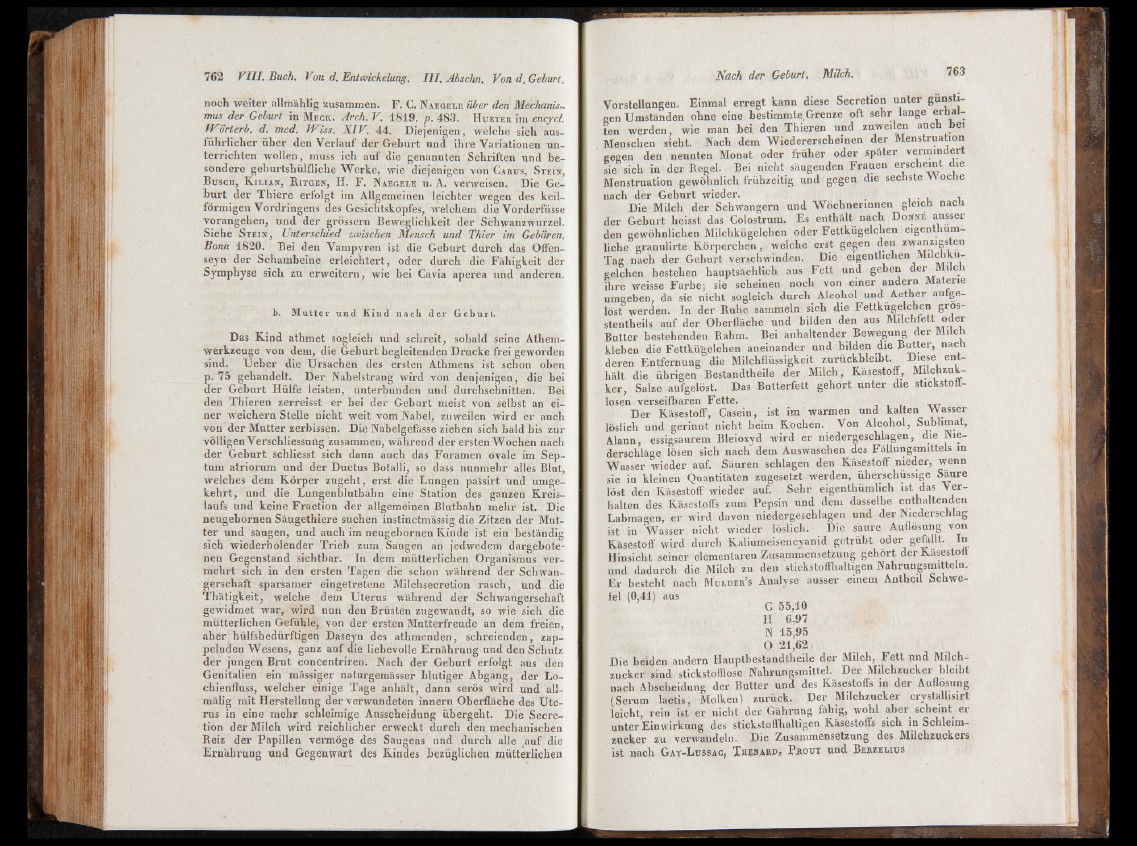
noch weiter allmählig zusammen. F. C. Naegele über den Mechanismus
der Geburt in M eck. Arch.V. 1819. p. 483. H ueter im encycl.
Wort erb. d. med. Wiss. XIV. 44. Diejenigen, welche sich ausführlicher
über den Verlauf der Gehurt und ihre Variationen unterrichten
wollen, muss ich auf die genannten Schriften und besondere
geburtshülfliche Werke, wie diejenigen von Carus, Stein,
B üsch, K ilian, R itgen, H. F. Naegele u . A. verweisen. Die Geburt
der Thiere erfolgt im Allgemeinen leichter wegen des keilförmigen
Vordringens des Gesichtskopfes, welchem die Vorderfüsse
vorangehen, und der grossem Beweglichkeit der Schwanzwurzel.
Siehe S t e in , Unterschied zwischen Mensch und Thier im Gebären.
Bonn 1820. Bei den Vampyren ist die Geburt durch das Offen-
seyn der Schambeine erleichtert, oder durch die Fähigkeit der
Symphyse sich zu erweitern, wie bei Cavia aperea und anderen.
b. M u t t e r u n d K in d n a c h d e r G e b u r t .
Das Kind athmet sogleich und schreit, sobald seine Athem-
Werkzeuge von dem, die Geburt begleitenden Drucke frei geworden
sind. Ueber die Ursachen des ersten Athmens ist schon oben
p. 75 gehandelt. Der Nabelstrang wird von denjenigen, die bei
der Geburt Hülfe leisten, unterbunden und durchschnitten. Bei
den Thieren zerreisst er bei der Geburt meist von selbst an einer
weichem Stelle nicht weit vom Nabel, zuweilen wird er auch
von der Mutter zerbissen. Die Nabelgefässe ziehen sich bald bis zur
völligen Verschliessung zusammen, während der ersten Wochen nach
der Geburt schliesst sich dann auch das Foramen ovale im Septum
atriorum und der Ductus Botalli, so dass nunmehr alles Blut,
welches dem Körper zugeht, erst die Lungen paSsirt und umgekehrt,
und die Lungenblutbahn eine Station des ganzen Kreislaufs
und keine Fraction der allgemeinen Blutbahn mehr ist. Die
neugebornen Säugethiere suchen instinctmässig die Zitzen der Mutter
und saugen, und auch im neugebornen Kinde ist ein beständig
sich wiederholender Trieb zum Sangen an jedwedem dargebotenen
Gegenstand sichtbar. In dem mütterlichen Organismus vermehrt
sich in den ersten Tagen die schon während der Schwangerschaft
sparsamer eingetretene Milchsecretion rasch, und die
Thätigkeit, welche dem Uterus während der Schwangerschaft
gewidmet war, wird nun den Brüsten zugewandt, so wié sich die
mütterlichen Gefühle, von der ersten Mutterfreude an dem freien,
aber hülfsbedürftigen Daseyn des athmenden, schreienden, zappelnden
Wesens, ganz auf die liebevolle Ernährung und den Schutz
der jungen Brut concentriren. Nach der Geburt erfolgt aus den
Genitalien ein massiger naturgemässer blutiger Abgang, der Lochienfluss,
welcher einige Tage anhält, dann serös wird und all—
mälig mit Herstellung der verwundeten innern Oberfläche des Uterus
in eine mehr schleimige Ausscheidung übergeht. Die Secre-
tion der Milch wird reichlicher erwéckt durch den mechanischen
Reiz der Papillen vermöge des Saugens und durch alle (auf die
Ernährung und Gegenwart des Kindes bezüglichen mütterlichen
Vorstellungen. Einmal erregt kann diese Secretion unter günstigen
Umständen ohne eine bestimmte,Grenze oft sehr lange erhalten
werden, wie man bei den Thieren und zuweilen auch bei
Menschen sieht. Nach dem Wiedererscheinen der Menstruation
gegen den neunten Monat oder früher oder später vermindert
sie sich in der Regel. Bei nicht säugenden Frauen erscheint die
Menstruation gewöhnlich frühzeitig und gegen die sechste Woche
nach der Geburt wieder. . ,
Die Milch der Schwängern und Wöchnerinnen gleich nach
der Geburt heisst das Colostrum. Es enthält nach D onne ausser
den gewöhnlichen Milchkügelchen oder Fettkügelchen eigenthum-
liche granulirte Körperchen, welche erst gegen den zwanzigsten
Tag nach der Geburt verschwinden. Die eigentlichen Mnchku-
gelchen bestehen hauptsächlich aus Fett und geben der Mi c
ihre weisse Farbe; sie scheinen noch von einer andern Materie
umgeben, da sie nicht sogleich durch Alcohol und Aether aufgelöst
werden. In der Ruhe sammeln sich die Fettkügelchen gros-
stentheils auf der Oberfläche und bilden den aus Milchfett oder
Butter bestehenden Rahm. Bei anhaltender Bewegung der Milch
kleben die Fettkügelchen aneinander und bilden die Butter, nach
deren Entfernung die Milchflüssigkeit zurückbleibt. Diese enthält
die übrigen Bestandtheile der Milch, Käsestoff, Milchzu -
ker, Salze aufgelöst. Das Butterfett gehört unter die stickstolt-
losen verseifbaren Fette.
Der Käsestoff, Casein, ist im warmen und kalten Wasser
löslich und gerinnt nicht beim Kochen. Von Alcohol, Sublimat,
Alaun, essigsaurem Bleioxyd wird er niedergeschlagen, die Niederschläge
lösen sich nach dem Auswaschen des Fällungsmittels m
Wasser wieder auf. Säuren schlagen den Käsestoff nieder, wenn
sie in kleinen Quantitäten zugesetzt werden, überschüssige Säure
löst den Käsestoff wieder auf. Sehr eigenthümlich ist das verhalten
des Käsestoffs zum Pepsin und dem dasselbe enthaltenden
Labmagen, er wird davon niedergeschlagen und der Niederschlag
ist in Wasser nicht wieder löslich. Die saure Auflösung von
Käsestoff wird durch Kaliumeisencyanid getrübt oder gefällt. In
Hinsicht seiner elementaren Zusammensetzung gehört der Kasestoit
und dadurch die Milch zu den stickstoffhaltigen Nahrungsmitteln.
Er besteht nach Mulder’s Analyse ausser einem Antheil Schwefel
(0,41) aus
’ C 55,10
H 6,97
N 15,95
O 21,62 i
Die beiden andern Hauptbestandtheile der Milch, Fett und Milchzucker
sind stickstofflose Nahrungsmittel. Der Milchzucker bleibt
nach Abscheidung der Butter und des Käsestoffs in der Auflösung
(Serum lactis, Molken) zurück. Der Milchzucker crystallisirt
leicht, rein ist er nicht der Gährung fähig, wohl aber scheint er
unter Ein wirkung des stickstoffhaltigen Käsestoffs sich in Schleim-
zucker zu verwandeln. Die Zusammensetzung des Milchzuckers
ist nach Gäy-Eussac, T henard, P rout und Berzelius