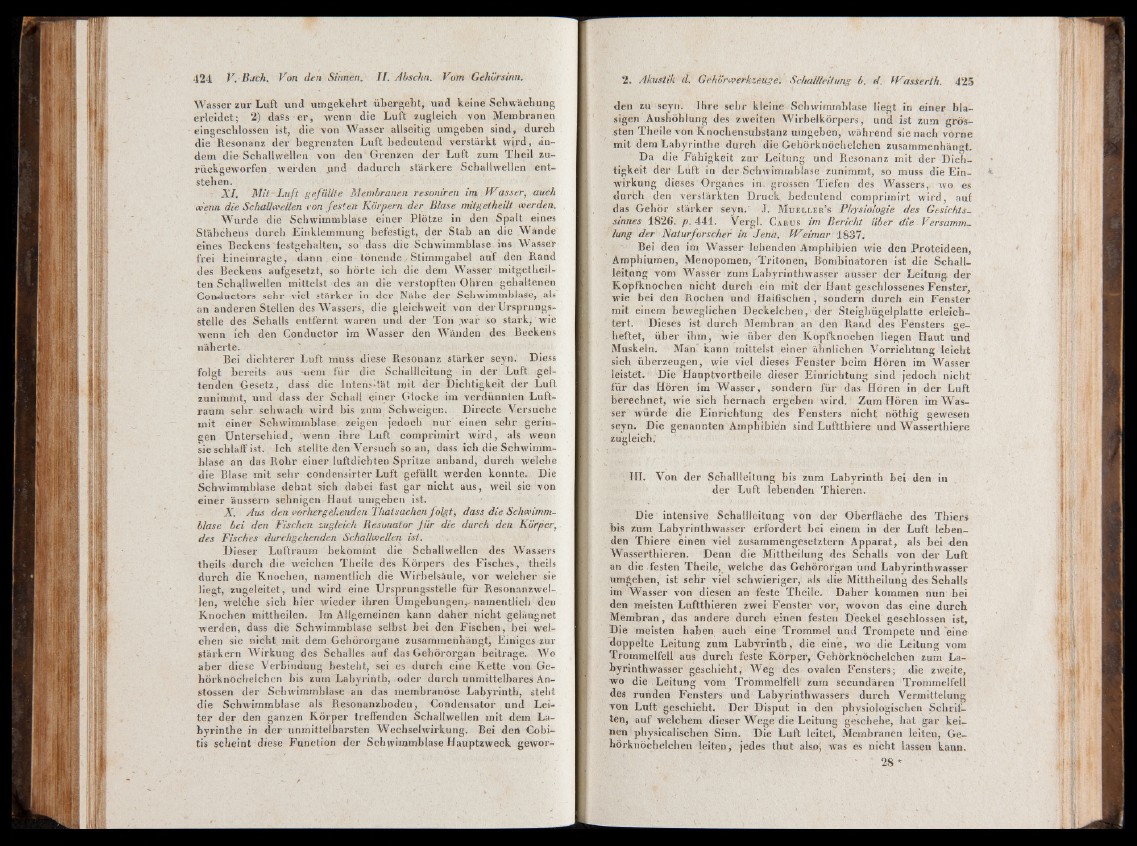
Wasser zur Luft und umgekehrt übergeht, und keine Schwächung
erleidet; 2) dass er, wenn die Luft zugleich von Membranen
eingeschlossen ist, die von Wasser allseitig umgeben sind, durch
die Resonanz der begrenzten Luft bedeutend verstärkt wjrd, andern
die Schallwellen von den Grenzen der Luft zum Theil zurückgeworfen.
werden und dadurch stärkere Schallwellen entstehen.
XI. Mit Luft gefüllte Membranen resoniren im kVasser, auch
wenn die Schallwellen ron festen Körpern der Blase mitgetheilt werden.
Wurde die Schwimmblase einer Plötze in den Spalt eines
Stäbchens durch Einklemmung befestigt, der Stab an die Wände
eines Beckens'festgehalten, so'dass die Schwimmblase ins Wasserfrei
hineinragte, dann eine tönende/Stimmgabel auf den Rand
des Beckens aufgesetzt, so hörte ich die dem Wasser mitgetheil-
ten Schallwellen mittelst des an die verstopften Ohren gehaltenen
Conductors sehr viel stärker in der Nähe der Schwimmblase, als
an anderen Stellen des Wassers, die gleichweit von der Ursprungsstelle
des Schalls entfernt waren und der Ton war so stark, wie
wenn ich den Conductor im Wasser den Wänden des Beckens
näherte.
Bei dichterer Luft muss diese Resonanz.stärker seyn.' Diess
folgt bereits aus -uem für die Schallleitung in der Luft geltenden
Gesetz, dass die Intensität mit der Dichtigkeit der Luft
zunimmt, und dass der Schall einer Glocke im verdünnten Luftraum
sehr schwach wird bis zuny Schweigen. Directe Versuche
mit einer Schwimmblase zeigen jedoch nur einen sehr geringen
Unterschied, wenn ihre Luft comprimirt wird, als wenn
sie schlaff ist. Ich stellte den Versuch so an, dass ich die Schwimmblase
an das Rohr einer luftdichten Spritze anhand, durch welche
' die Blase mit sehr condensirter Luft gefüllt werden konnte. Die
Schwimmblase dehnt sich dabei fast gar nicht aus, weil sie von
einer äussern sehnigen Haut umgeben ist.
X. Aus den vorhergehenden That sacken folgt, dass die Schwimmblase
bei den Fischen zugleich Resonator fü r die durch'den Körper,
des Fisches durchgehenden Schallwellen ist.
D ieser Luftraum bekommt die Schallwellen des Wassers
tbeils durch die weichen Theile des Körpers des Fisches,- theils
durch die Knochen, namentlich dié Wirbelsäule, vor welcher sie
liegt, zugeleitet, und wird eine Ursprungsstelle für Resonanzwellen,
welche sich hier wieder ihren Umgebungen^ namentlich den
Knochen mittheilen. Im Allgemeinen kann daher nicht geläugnet
werden, dass die Schwimmblase selbst bei den Fischen, bei welchen
sie nicht mit dem Gehörorgane zusammenhängt, Einiees zur
starkem Wirkung des Schalles auf das Gehörorgan beitrage. Wo
aber diese Verbindung besteht, sei es durch eine Kette von Gehörknöchelchen
bis zum Labyrinth, oder durch unmittelbares An-
stossen der Schwimmblase an das membranöse Labyrinth, steht
die Schwimmblase als Resonanzboden, 'Condensator und Leiter
der den ganzen Körper treffenden Schallwellen mit dem Labyrinthe
in der unmittelbarsten Wechselwirkung. Bei den Cobi-
tis scheint diese Function der Schwimmblase Hauptzweck gêworden
zu seyn. Ihre sehr kleine Schwimmblase liegt in einer blasigen
.Aushöhlung des zweiten Wirbelkörpers, und ist zum grössten
Theile von Knochensubslanz umgeben, während sie nach vörne
mit dem Labyrinthe durch die Gehörknöchelchen zusammenhängt.
Da die Fähigkeit zur Leitung und Resonanz mit der Dichtigkeit
der Luft in der Schwimmblase zunimmt, so muss die Einwirkung
dieses Organes in. grossen Tiefen des Wassers, wo es
durfch den verstärkten Druck bedeutend comprimirt wird, auf
das Gehör stärker seyn.' J. Mueller’s Physiologie des Gesichtssinnes
1826. p. 441. Vergl. Carus im Bericht über die - Versammlung
der Naturforscher in Jena. kFeimar 1837.
Bei den im Wasser lebenden Amphibien wie den Proteideen,
Amphiumen, Menopomen, Tritonen, Bombinatoren ist die Schall-
leitnng vom Wasser zum Labyrinthwasser ausser der Leitung, der
Kopfknochen nicht durch ein mit der Haut geschlossenes Fenster,
wie bei den Rochen und Haifischen , sondern durch ein Fenster
mit einem beweglichen Deckelchen, der Steigbügelplatte erleichtert.
Dieses ist durch Membran an den Rand des Fensters geheftet,
über ihm, .wie über den Kopfknochen liegen Haut und
Muskeln. Man- kann mittelst einer ähnlichen Vorrichtung leicht
sich überzeugen, wie viel dieses Fenster beim Hören im Wasser
leiste!.' Die Hauptvortheile dieser Einrichtung sind jedoch nicht
für das Hören im Wasser, sondern für das Hören in der Luft
berechnet, wie isich hernach ergeben wird. Zum Hören im Wasser
würde die Einrichtung des Fensters nicht nöthig gewesen
seyn. Die genannten Amphibidn sind Luftthiere und Wasserthiere
zugleich,
III. Von der Schallleitung bis zum Labyrinth bei den in
der Luft lebenden Thieren.
Die' intensive Schallleitung von der Oberfläche des Thiers
bis zum Labyrinthwasser erfordert bei einem in der Luft lebenden
Thiere einen viel zusammengesetztem Apparat, als bei den
Wasserthieren. Denn die Mittheilung des Schalls von der Luft
an die festen Theile, welche das Gehörorgan und Labyrinthwasser
umgeben, ist sehr viel schwieriger, als die Mittheilung des Schalls
im Wasser von diesen an feste Theile. Daher kommen nun bei
den meisten Luftthieren zwei Fenster vor, wovon das eine durch
Membran, das andere durch einen festen Deckel' geschlossen ist,
Die meisten haben auch eine Trommel urul Trompete und 'eine
doppelte Leitung zum Labyrinth, die eine, wo die Leitung vom
Trommelfell aus durch feste Körper, Gehörknöchelchen zum Labyrinthwasser
geschieht, Weg des ovalen Fensters; die zweite,
wo die Leitung vom Trommelfell zum secundären Trommelfell
des runden Fensters und Labyrinthwassers durch Vermittelung
von Luft geschieht. Der Disput in den physiologischen Schriften,
auf welchem dieser Wege die Leitung geschehe, hat gar keinen
physicalischen Sinn. Die Luft leitet, Membranen leiten, Gehörknöchelchen
leiten, jedes thut also, was es nicht lassen kann.