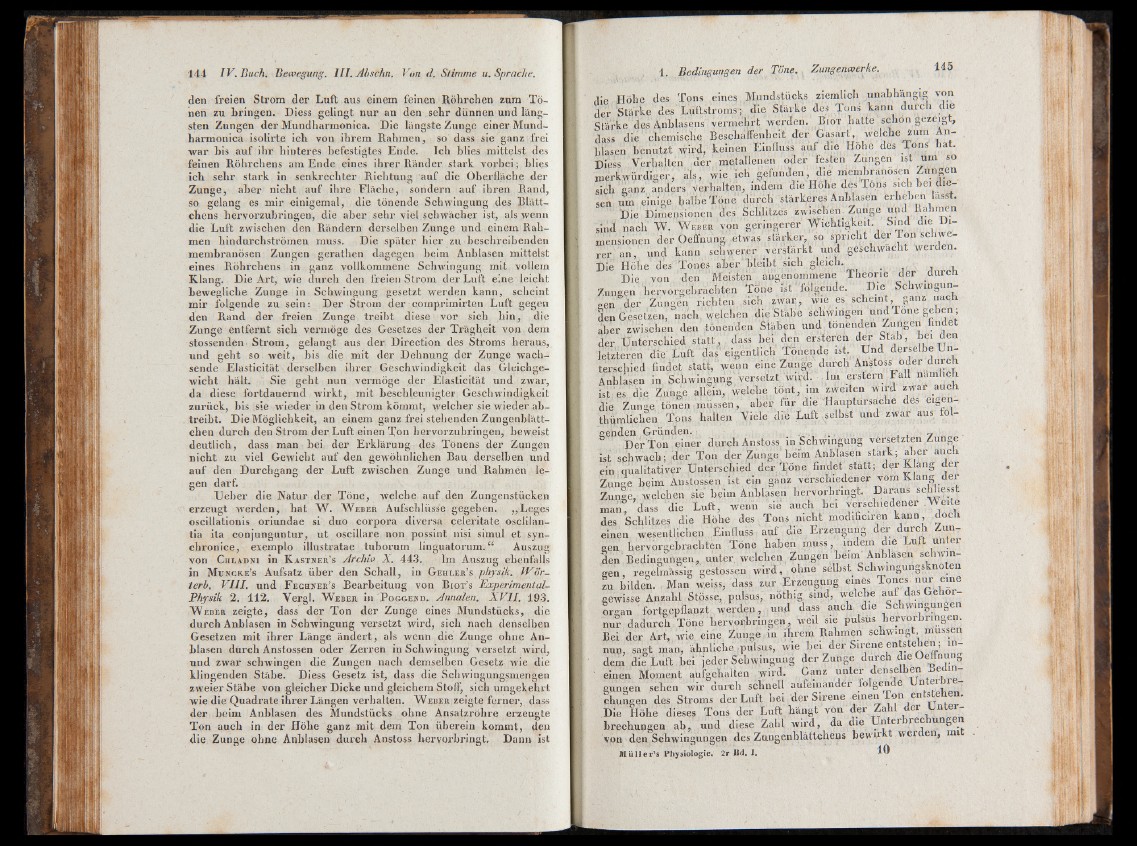
den freien Strom der Luft aus einem feinen Röhrchen zum Tönen
zu bringen. Diess gelingt nur an den „sehr dünnen und längsten
Zungen der Mundharmonica. Die längste Zunge einer Mund-
harmonica isolirte ich von ihrem Rahmen, so dass sie ganz frei
war bis auf ihr hinteres befestigtes Ende. Ich blies mittelst des
feinen Röhrchens am Ende eines ihrer Ränder, stark vorbei; blies
ich sehr stark in senkrechter Richtung auf die Oberfläche der
Zunge, aber nicht auf ihre Fläche, sondern auf ihren Rand,
so gelang es mir einigemal, die tönende Schwingung des Blättchens
hervorzubringen, die aber sehr viel schwächer ist, als wenn
die Luft zwischen den Rändern derselben Zunge und einem Rahmen
hindurchströmen muss. Die später hier zu beschreibenden
membranösen Zungen gerathen dagegen beim Anblasen mittelst
eines Röhrchens in ganz vollkommene Schwingung mit vollem
Klang. Die Art,' wie durch den freien Strom der Luft eine leicht
bewegliche Zunge in Schwingung gesetzt werden kann, scheint
mir folgende zu sein: Der Strom der comprimirten Luft gegen
den Rand der freien Zunge treibt diese* vor sich hin, die
Zunge entfernt sich vermöge des Gesetzes der Trägheit von dem
stossenden■ Strom, gelangt aus der Direction des Stroms heraus,
und seht so weit, bis die mit der Dehnung der Zunge wachsende
Elasticität derselben ihrer Geschwindigkeit das Gleichgewicht
hält. Sie geht nun vermöge der Elasticität und zwar,
da diese fortdauernd wirkt, mit beschleunigter Geschwindigkeit
zurück, bis sie wieder in den Strom kömmt, welcher sie wieder abtreibt.
Die Möglichkeit, an einem ganz frei stehenden Zungenblättchen
durch den Strom der Luft einen Ton hervorzubringen, beweist
deutlich, dass man bei der Erklärung • des Tönens der Zungen
nicht zu viel Gewicht auf den gewöhnlichen Bau derselben und
auf den Durchgang der Luft zwischen Zunge und Rahmen legen
darf.
lieber die Natur der Töne, welche auf den Zungenstücken
erzeugt werden, hat W. W eber Aufschlüsse gegeben. „Leges
oscillationis oriundae si duo corpora diversa celeritate osclilan-
tia ita conjunguntur, ut oscillare non possint nisi simul et syn-
chronice, exemplo illustratae tuborum linguatorum.“ Auszug
von Chladni in K astner’s Afchiv X. 443. Im Auszug ebenfalls
in Muncke’s Aufsatz über den Schall, in Gehler’s physik. Wör-
terh. VIII. und F echner’s Bearbeitung von B iot’s Experimental-
Physik 2. 112. Vergl. W eber in 'P oggehd. Annalen. XVII. 193.
W eber zeigte, dass der Ton der Zunge eines Mundstücks, die
durch Anblasen in Schwingung versetzt wird, sich nach denselben
Gesetzen mit ihrer Länge ändert, als wenn die Zunge ohne Anblasen
durch Anstossen oder Zerren in Schwingung versetzt wird,
und zwar schwingen die Zungen nach demselben Gesetz wie die
klingenden Stäbe. Diess Gesetz ist, dass die Schwingungsmengen
zweier Stäbe von gleicher Dicke und gleichem Stoff, sich umgekehrt
wie die Quadrate ihrer Längen verhalten. W eber zeigte ferner, dass
der beim Anblasen des Mundstücks ohne Ansatzröhre erzeugte
Ton auch in der Höhe ganz mit dem Ton überein kommt, den
die Zunge ohne Anblasen durch Anstoss hervorbringt. Dann ist
die Höhe des Tons „eines,. Mundstücks ziemlich unabhängig von
der Stärke des Luftstroms^ die> Stärke des Tons kann durch die
Stärke cles Anblasens vermefert werden. Biot hatte schon ^ezejg ,
dass die chemische Beschaffenheit der Gasart, welche^um An-
blasen benutzt wird, keinen Einfluss auf die Höhe des Tons hat.
Diess Verhalten der metallenen oder festen Zungen ist um so
merkwürdiger, als, wie ich gefunden, die membranosen Züngen
sich ganz anders v erb a lten, in dem die Höhe des Tons sich bei diesen
um einige halbe Töne durch stärkeres Anblasen erheben lasst.
Die’Dimensionen des Schlitzes zwischen. Zunge und Rahmen
sliiii nach W. Weber von geringerer'Wichtigkeit. Sind die Dimensionen
der Öeffnung’etwas stärker, so spricht der Ton schwere
r'an ,' und hann schwerer Verstärkt und geschwächt werden.
Die Höhe dés Wonès aber "Bleibt.-sich, gleich. . . , ,
UiAii'VAn Theorie der duren
Zungen hervorgebrächten Töne ist "fpti>ende. .Die Schwingungen
der Ziingën richten .sich zwar, wie es scheint, ganz nach
den Gesetzen, nach, vvelchen die'Stäbe schwingen und Tone geben;
aber 'zwischen den tönenden Stäben und tonenden Zungen findet
der Unterschied statt, dass bei den ersteren der Stab, bei den
letzteren die' Luft das' eigentlich Tönende ist.U n d . derselbe Unterschied
findet statt, wenn eine Zunge durch Anstoss oder durch
Anblasen in Schwingung' versetzt 'wird. . Im erslern Fall namhch
ist “es die Zunge allein, welche töpt, im zweiten wird zwar auch
dié Zunge tönen müssen,, aber für die 'Hauptursache dés eigen-
thümlichen Tons halten Viele die Luit selbst und zwar aus folgenden
Gründen- . , . , . _
Der Ton einer durch Anstoss( in Schwingung versetzten Zun^e
ist schwach; ,der Ton der Zunge'beim Anblasen stärk; aber auch
ein qualitativer Unterschied der l'öno findet statt; dgr Klang der
Zurige beim Ahstossen ist . ein gänz verschiedener Vom Klang der
Z u n g e , welchen sie' beim Anblasen hervorbringt. Daraus Schhesst
mah! dass die Luft, wenn sie auch bei verschiedener .Weite
des Schlitzes die Höhe des Tons nicht modificiren kann doch
einen wesentlichen Einfluss| auf die Erzeugung der durch Zungen
hervorgebrächten Töpe haben muss, indem die Luft unter
den'Bedingungen, unter, welchen Zungen“ Leinf Anblasen schwingen
, regelmässig gestossen wird, ohne selbst Schwingungsknoten
zu bilden. Man w.eiss, dass, zur Erzeugung eines Tones, nur eine
gewisse Anzahl Stösse, pulsus, nöthig sind, welche auf das Gehörorgan
fortgepflanzt werden, und dass auch die Schwingungen
nur dadurch Töne heryorbringen, weil sie pulsüs hervorbringen.
Bei der Art, wie eine Zunge in ihrem Rahmen schwingt, mossen
nun, sagt man, ähnliche ,pulsus, wie bei der Sirene entstehen; indem
die Luft bei jeder Schwingung der Zunge durch dieOeffnun0
einen Moment aufgehalten wird. Ganz unter denselben Bedingungen
sehen wir durch schnell aüfeinander folgende Unterbrechungen
des Stroms der Luft bei'der Sirene emeiUTon entstehen.
Die Höhe dieses Tons der Luft hängt von der Zahl der Unterbrechungen
ab, und diese Zahl wird, da die Unterbrechungen
von den Schwingungen des Zungenblättchens hewrf t wer en, mi
M iille r’s Physiologie. 2r JJd, I. . 1 0