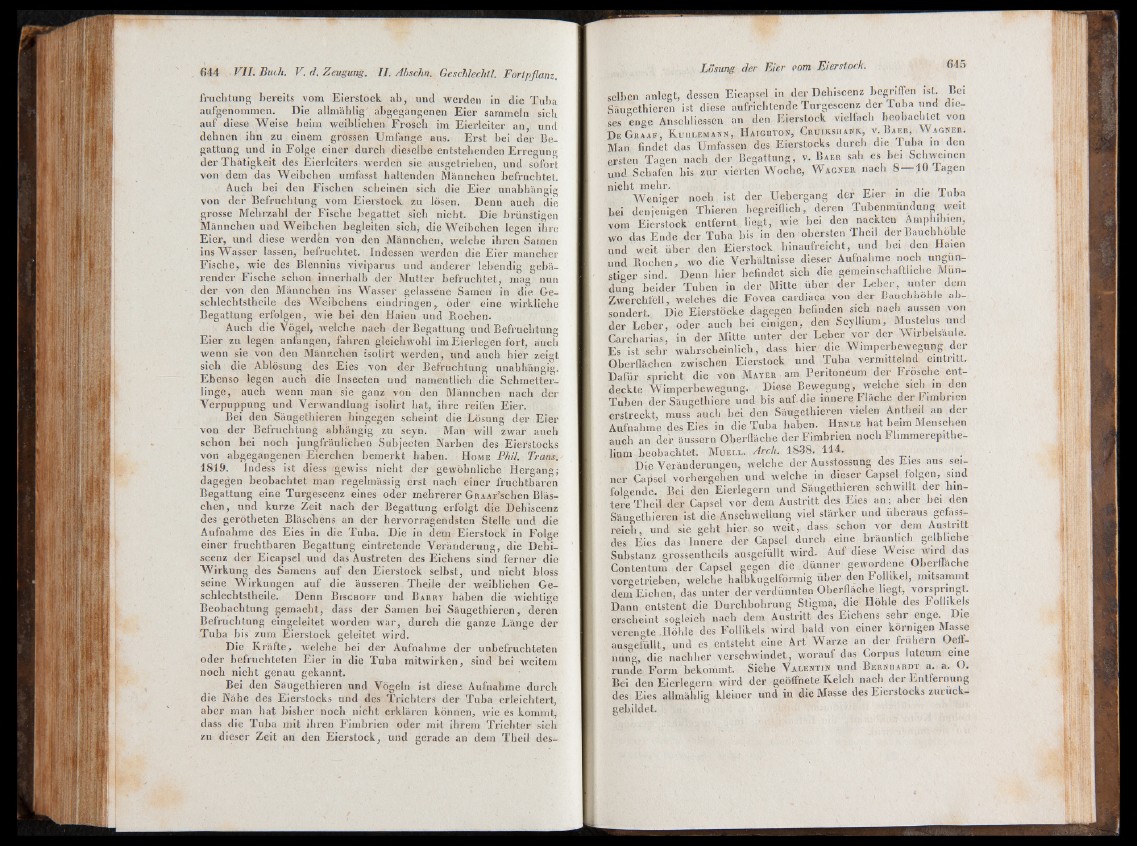
fruchtung bereits vom Eierstock ab, und werden in die Tuba
aufgenommen. Die allmählig' abgegangenen Eier sammeln sieb
auf diese Weise beim weiblichen Frosch im Eierleiter an, und
dehnen ihn zu einem grossen Umfange aus. Erst bei der Begattung
und in Folge einer durch dieselbe entstehenden Erregung
der Thätigkeit des Eierleiters werden sie ausgetrieben, und sofort
von dem das Weibchen umfasst haltenden Männchen befruchtet.
Auch bei den Fischen scheinen sich die Eier unabhängig
von der Befruchtung vom Eierstock zu lösen. Denn auch die
grosse Mehrzahl der Fische begattet sich nicht. Die brünstigen
Männchen und Weibeben begleiten sich, die Weibchen legen ihre
Eier, und diese werden von den Männchen, welche ihren Samen
ins Wasser lassen, befruchtet. Indessen werden die Eier mancher
Fische, wie des Blennius viviparus und anderer lebendig gebärender
Fische schon innerhalb der Mutter befruchtet, mag nun
der von den Männchen ins Wasser gelassene Samen in die Ge-
schlechtstheile des Weibchens Eindringen, öder eine wirkliche
Begattung erfolgen, wie bei den Haien und Rochen.
Auch die Vögel, welche nach der Begattung und Befruchtung
Eier zu legen anfangen, fahren gleichwohl im Eierlegen fort, auch
wenn sie von den Männchen isolirt werden, und auch hier zeigt
sich die Ablösung des Eies von der Befruchtung unabhängig.
Ebenso legen auch die Insecten und namentlich die Schmetterlinge,
auch wenn man sie ganz von den Männchen nach der
Verpuppung und Verwandlung isolirt hat, ihre reifen Eier.
Bei den Säugethieren hingegen scheint die Lösung der Eier
von der Befruchtung abhängig zu seyn. Man will zwar auch
schon bei noch jungfräulichen Subjecten Narben des Eierstocks
von abgegangenen Eierchen bemerkt haben. H ome Phil. Trans.
1819. Indess ist diess 'gewiss nicht der gewöhnliche Hergang;
dagegen beobachtet man regelmässig erst nach einer fruchtbaren
Begattung eine Tui'gescenz eines oder mehrerer GRAAF’schen Bläschen,
und kurze Zeit nach der Begattung erfolgt die Dehiscenz
des gerötheten Bläschens an der hervorragendsten Stelle und die
Aufnahme des Eies in die Tuba. Die in dem Eierstock in Folge
einer fruchtbaren Begattung eintretende Veränderung, die Dehiscenz
der Eicapsel und das Austreten des Eichen« sind ferner die
Wirkung des Samens auf den Eierstock selbst, und nicht bloss
seine Wirkungen auf die äusseren Theile der weiblichen Ge-
schlechtstheile. Denn Bischöfe und Barry haben die wichtige
Beobachtung gemacht, dass der Samen bei Säugethieren, deren
Befruchtung eingeleitet worden war, durch die ganze Länge der
Tuba bis zum Eierstock geleitet wird.
Die Kräfte, welche bei der Aufnahme der unbefruchteten
oder befruchteten Eier in die Tuba initwirken, sind bei weitem
noch nicht genau gekannt.
Bei den Säugethieren und Vögeln ist diese Aufnahme durch
die Nähe des Eierstocks und des Trichters der Tuba erleichtert,
aber man hat bisher noch nicht erklären können, wie es kommt,
dass die Tuba mit ihren Fimbrien oder mit ihrem Trichter sich
zu dieser Zeit an den Eierstock, und gerade an dem Theil desselben
anlegt, dessen Eicapsel in der Dehiscenz begriffen ist. Bei
Säugethieren ist diese aufrichtende Turgescenz der Tuba und dieses
enge Anschliessen an den Eierstock vielfach beobachtet von
D e Graaf, K uhlemann, H aiguton, Cruikshan*, v.B af.r, W agner.
Man findet das Umfassen des Eierstocks durch die Tuba in den
ersten Tagen nach der Begattung, v. B aer sah es bei Schweinen
und Schafen bis zur vierten Woche, W agner nach 8 — 10 lagen
nicht mehr. «Spj f ,
Weniger noch ist der Uebergang der Eier in die luba
bei denjenigen Thieren begreiflich, deren Tubenmündung weit
vom Eierstock entfernt liegt, wie bei den nackten Amphibien,
wo das Ende der Tuba bis in den obersten Th eil der B auchhöhle
und weit über den Eierstock hinaufreicht, und bei den Haien
und Rochen, wo die Verhältnisse dieser Aufnahme noch ungünstiger
sind Denn hier befindet sich die gemeinschaftliche Mündung
beider Tuben in der Mitte über der Leber, unter dem
Zwerchfell, welches die Fovea cardiaca von der Bauchhöhle absondert.
Die Eierstöcke dagegen befinden sich nach aussen von
der Leber, oder auch bei einigen, den Scyllium, Mustelus und
Carcharias, in der Mitte unter der Leber vor der Wirbelsäule.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier'die Wimperbewegung der
Oberflächen zwischen Eierstock und Tuba vermittelnd emtritl.
Dafür spricht die von Mayer am Peritoneum der Frosche entdeckte
Wimperbewegung. Diese Bewegung, welche sich in den
Tuben der Säugethiere und bis auf. die innere Fläche der Fimbrien
erstreckt, muss auch bei den Säugethieren vielen Antheil an der
Aufnahme des Eies in die Tuba haben. H enle hat beim Menschen
auch an der äussern Oberfläche der Fimbrien noch Fhmmerepithe-
lium beobachtet. Muell. Arcli. 1838. 114.
Die Veränderungen, welche der Ausstossung des Eies aus seiner
Capsel vorhergehen und welche in dieser Capsel folgen, sind
folgende. Bei den Eierlegern und Säugethieren schwillt der hintere
Theil der Capsel vor dem Austritt des Eies an ; aber bei den
Säugethieren ist die Anschwellung viel stärker und überaus gefäss-
reich, und sie geht hier, so weit, dass schon vor dem Austritt
des Eies das Innere der Capsel durch eine bräunlich gelbliche
Substanz grossentheils ausgefüllt wird. Auf diese Weise wird das
Contentum der Capsel gegen die . dünner gewordene Oberfläche
vorgetrieben, welche halbkugelförmig über den Follikel, mitsammt
dem Eichen, das unter der verdünnten Oberfläche liegt, vorspringt.
Dann entstent die Durchbohrung Stigma, die Höhle des Follikels
erscheint sogleich nach dem Austritt des Eichens sehr enge. Hie
verengte Höhle des Follikels wird hald von einer körnigen Masse
ausgefüllt, und es entsteht eine Art Warze an der frühem Oeff-
nung, die nachher verschwindet, worauf das Corpus luteum eine
runde Form bekommt. Siehe V alentin und Bernhardt a. a. O.
Bei den Eierlegern wird der geöffnete Kelch nach der Entfernung
des Eies allmählig kleiner und in die Masse des Eierstocks zuruck-
gebildet.