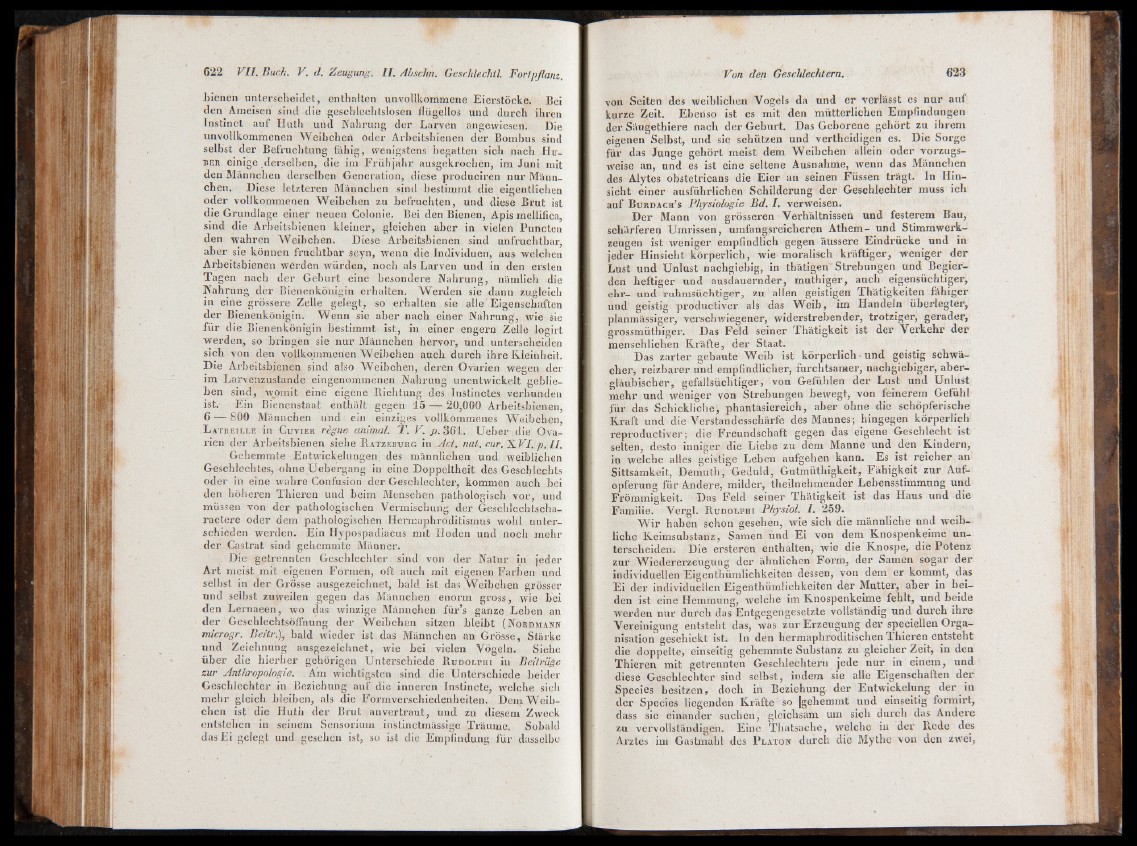
Bienen unterscheidet, enthalten unvollkommene Eierstöcke. Bei
den Ameisen sind die geschlechtslosen flügellos und durch ihren
Instinct auf Iluth und Nahrung der Larven angewiesen. Die
unvollkommenen Weibchen oder Arbeitsbienen der Bombus sind
selbst der Befruchtung fähig, wenigstens begatten sich nach Huber
einige derselben, die im Frühjahr ausgekrochen, im Juni mit
den Männchen derselben Generation, diese produciren nur Männchen.
Diese letzteren Männchen sind bestimmt die eigentlichen
oder vollkommenen Weibchen zu befruchten, und diese Brut ist
die Grundlage einer neuen Colonie. Bei den Bienen, Apis mellifica,
sind die Arbeitsbienen kleiner, gleichen aber in vielen Puncten
den wahren Weibchen. Diese Arbeitsbienen sind unfruchtbar,
aber sie können fruchtbar seyn, wenn die Individuen, aus welchen
Arbeitsbienen werden würden, noch als Larven und in den ersten
Tagen nach der Geburt eine besondere Nahrung, nämlich die
Nahrung der Bienenkönigin erhalten. Werden sie dann zugleich
in eine grössere Zelle gelegt, so erhalten sie alle'Eigenschaften
der Bienenkönigin. Wenn sie aher nach einer Nahrung, wie sie
für die Bienenkönigin bestimmt ist, in einer engern Zelle logirt
werden, so bringen sie nur Männchen hervor, und unterscheiden
sich von den vollkommenen Weibchen auch durch ihre Kleinheit.
Die Arbeitsbienen sind also Weibchen, deren Ovarien wegen der
im Larvenzustande eingenommenen Nahrung unentwickelt geblieben
sind, Cwomit eine eigene Richtung des Distinctes verbunden
ist. Ein Bienenstaat enthält gegen 15— 20,000 Arbeitsbienen,
6 — 800 Männchen und ein einziges ^vollkommenes Waibchen,
. L a t r e i l l e in C u v i e r règne animal. T. V. j». 361. Ueber die Ovarien
der Arbeitsbienen siehe R a t z e b u r g in Act. nat, cur.~K.VI. p. II.
Gehemmte Entwickelungen des männlichen und weiblichen
Geschlechtes, ohne Uebergang in eine Doppeltheit des Geschlechts
oder in eine wahre Confusion der Geschlechter, kommen auch bei
den höheren Thieren und beim Menschen pathologisch vor, und
müssen von der pathologischen Vermischung der Geschiechtscha-
ractere oder dem pathologischen Hermaphroditismus wohl unterschieden
werden. Ein Hypospadiacus mit Hoden und noch mehr
der Castrat sind gehemmte Männer.
Die getrennten Geschlechter sind von der Natur in jeder
Art meist mit eigenen Formen, oft auch mit eigenen Farben und
selbst in der Grösse ausgezeichnet, bald ist das Weibchen grösser
und selbst zuweilen gegen das Männchen enorm gross, wie bei
den Lernaeen, wo das winzige Männchen für’s ganze Leben an
der Geschlechtsöffnung der Weibchen sitzen bleibt (Nordmann
microgr. Beitr.), bald wieder ist das Männchen an Grösse, Stärke
und Zeichnung ausgezeichnet, wie bei vielen Vögeln. Siehe
über die hierher gehörigen Unterschiede Rudolphi in Beiträge
zur Anthropologie. . Am wichtigsten sind die Unterschiede beider
Geschlechter in Beziehung auf die inneren Instincte, welche sich
mehr gleich bleiben, als die Form Verschiedenheiten. Dem Weibchen
ist die Huth der Brut anvertraut, und zu diesem Zweck
entstehen in seinem Sensorium instinctmässige Träume. Sobald
das Ei gelegt und gesehen ist, so ist die Empfindung für dasselbe
von Seiten des weiblichen Vogels da und er verlässt es nur auf
kurze Zeit. Eberiso ist es mit den mütterlichen Empfindungen
der Säugethiere nach der Geburt. Das Geborene gehört zu ihrem
eigenen Selbst, und sie schützen und vertheidigen es. Die Sorge
für das Junge gehört meist dem Weibchen allein oder vorzugsweise
an, und es ist eine seltene Ausnahme, wenn das Männchen
des Alytes obstetricans die Eier an seinen Füssen trägt. In Hinsicht
einer ausführlichen Schilderung der Geschlechter muss ich
auf Burda ch’s Physiologie Bd. I. verweisen.
Der Mann von grösseren Verhältnissen und festerem Bau,
schärfere^ Umrissen, umfangsreicheren Athem- und Stimmwerkzeugen
ist weniger empfindlich gegen äussere Eindrücke und in
jeder Hinsicht körperlich, wie moralisch kräftiger, weniger der
Lust und Unlust nachgiebig, in thätigen Strebungen und Begierden
heftiger und ausdauernder, muthiger, auch eigensüchtiger,
ehr- und ruhmsüchtiger, zu allen geistigen Thätigkeiten fähiger
und geistig productiver al$ das Weib, im Handeln überlegter,
planmässiger, verschwiegener, widerstrebender, trotziger, gerader,
grossmüthiger. Das Feld seiner Thätigkeit ist der Verkehr der
menschlichen Kräfte, der Staat.
Das zarter gebaute Weib ist körperlich - und geistig schwächer,
reizbarer und empfindlicher, furchtsamer, nachgiebiger, abergläubischer,
gefallsüchtiger, von Gefühlen der Lust und Unlust
mehr und weniger von Strebungen bewegt, von feinerem Gefühl
für das Schickliche', phantasiereich, aber ohne die schöpferische
Kraft und die Verstandesschärfe des Mannes; hingegen körperlich
reproductiver; die Freundschaft gegen das eigene Geschlecht ist
selten, desto inniger die Liehe zu dem Manne und den Kindern,
in welche alles geistige Leben aufgehen kann. Es ist reicher an
Sittsamkeit, Demuth, Geduld, Gutmüthigkeit, Fähigkeit zur Aufopferung
für Andere, milder, theilnebmender Lebensstimmung und
Frömmigkeit. Das Feld seiner Thätigkeit ist das Haus und die
Familie. Vergl. Rudolphi Physiol. I. 259.
Wir haben schon gesehen, wie sich die männliche und weibliche
Keimsuhstanz, Samen und Ei von dem Knospenkeime unterscheiden.
Die ersteren enthalten, wie die Knospe, die Potenz
zur Wiedererzeugung der ähnlichen Form, der Samen sogar der
individuellen Eigenthümlichkeiten dessen, von dem er kommt, das
Ei der individuellen Eigenthümlichkeiten der Mutter, aber in beiden
ist eine Hemmung, welche im Knospenkeime fehlt, und beide
werden nur durch das Entgegengesetzte vollständig und durch ihre
Vereinigung entsteht das, was zur Erzeugung der speziellen Organisation
geschickt ist. In den hermaphroditischen Thieren entsteht
die doppelte, einseitig gehemmte Substanz zu gleicher Zeit, in den
Thieren mit getrennten Geschlechtern jede nur in einem, und
diese Geschlechter sind selbst, indem sie alle Eigenschaften der
Species besitzen, doch in Beziehung, der Entwickelung der in
der Species liegenden Kräfte so |gehemmt und einseitig formirt,
dass sie einander suchen, gleichsam um sich durch das Andere
zu vervollständigen. Eine Tbatsache, welche in der Rede des
Arztes im Gastmahl des P laton durch die Mythe von den zwei,