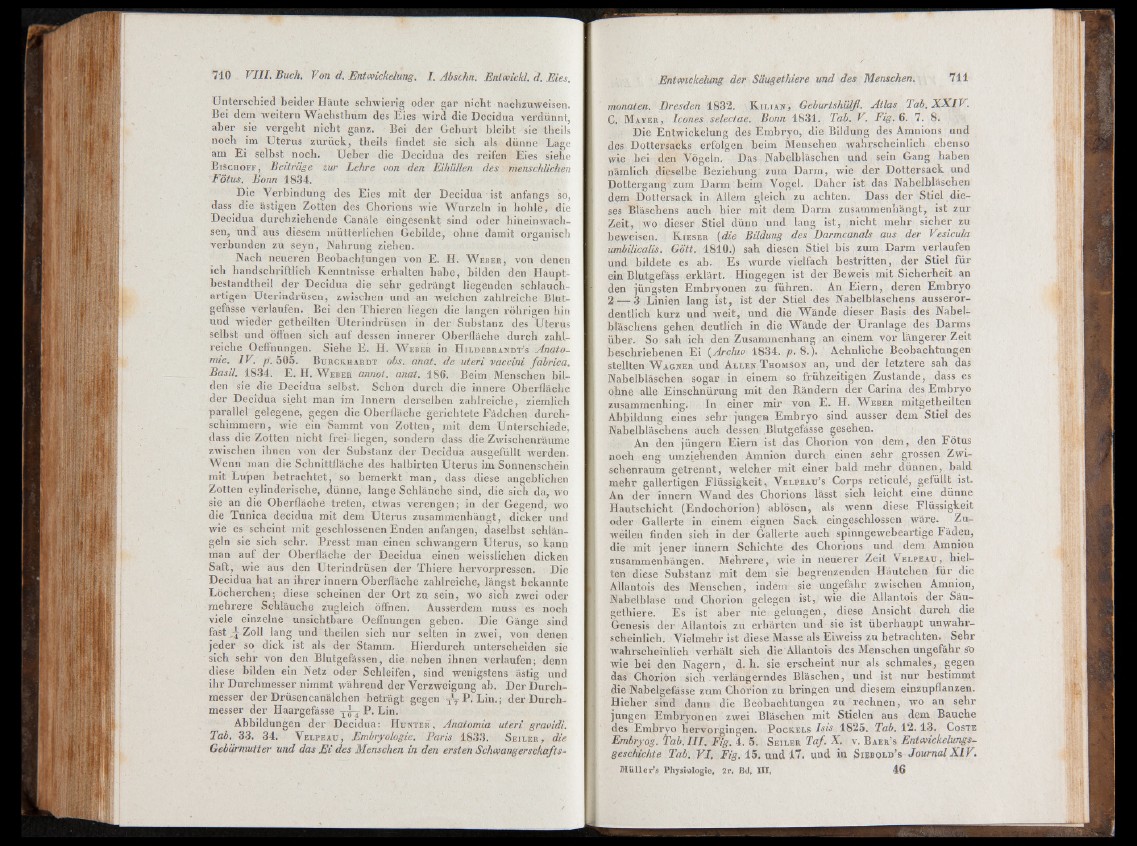
Unterschied beider Häute schwierig oder gar nicht nachzuweisen.
Bei dem weitern Wachsthum des Eies wird die Decidua verdünnt,
aber sie vergeht nicht ganz. Bei der Gehurt bleibt sie theils
noch im Uterus zurück, theils findet sie sich als dünne Lage
am Ei selbst noch. Ueher die Decidua des reifen Eies siehe
B ischoff, Beiträge zur Lehre von den Eihüllen des menschlichen
Fötus. Bonn 1834.
Die Verbindung des Eies mit der Decidua ist anfangs so,
dass die ästigen Zotten des Chorions wie Wurzeln' ip hohle, die
Decidua durchziehende Canäle eingesenkt sind oder hineinwachsen,
und aus diesem mütterlichen Gebilde, ohne damit organisch
verbunden zu seyn, Nahrung ziehen.
Nach neueren Beobachtungen von E. Id. W eber, von denen
ich handschriftlich Kenntnisse erhalten habe, bilden den Hauptbestandteil
der Decidua die sehr gedrängt liegenden schlauchartigen
Uterindrüsen, zwischen und an welchen zahlreiche Blutgefässe
verlaufen. Bei den Thieren liegen die langen rührigen hin
und wieder geteilten 'Uterindrüsen in der Substanz des Uterus
seihst und öffnen sich auf dessen innerer Oberfläche durch zahlreiche
Oeffnungen. Siehe E. H. W eber in H ildebrandt’s Anatomie.
IV. p. 505. Burckhardt obs. anat. de uteri vaccini fabrica.
Basil. 1834. E. H. W eber ünnot. anat. 186. Beim, Menschen bilden
sie die Decidua selbst. Schon durch die innere Oberfläche
der Decidua sieht man im Innern derselben zahlreiche, ziemlich
parallel gelegene, gegen die Oberfläche gerichtete Fädchen durchschimmern,
wie ein Sammt von Zotten, mit dem Unterschiede,
dass die Zotten nicht frei- liegen, sondern dass die Zwischenräume
zwischen ihnen von der Substanz der Decidua ausgefüllt werden.
Wenn man die Schnittfläche des halbirten Uterus im Sonnenschein
mit Lupen betrachtet, so bemerkt man, dass diese angeblichen
Zotten erfinderische, dünne, lange Schläuche sind, die sich da, wo
sie an die Oberfläche treten, etwas verengen; in der Gegend, wo
die Tunica decidua mit dem Uterus zusammenhängt, dicker und
wie es scheint mit geschlossenen Enden anfahgen, daselbst schlängeln
sie sich sehr. Presst man einen schwängern Uterus, so kann
man auf der Oberfläche der Decidua einen weissliehen dicken
Saft, wie aus den Uterindrüsen der Thiere hervorpressen. Die
Decidua hat an ihrer innern Oberfläche zahlreiche, längst bekannte
Löcherchen; diese scheinen der Ort zu sein, wo sich zwei oder
mehrere Schläuche zugleich öffnen. Ausserdem muss es noch
viele einzelne unsichtbare Oeffnungen geben. Die Gänge sind
fast ^ Zoll lang und theilen sich nur selten in zwei, von deüen
jeder so dick ist als der Stamm. Hierdurch unterscheiden sie
sich sehr von den Blutgefässen, die neben ihnen verlaufen; denn
diese bilden ein Netz oder Schleifen, sind wenigstens ästig und
ihr Durchmesser nimmt während der Verzweigung ah. Der Durchmesser
der Drüsencanälchen beträgt gegen TlT P. Lin.; der Durchmesser
der Haargefässe '4-^j P. Lin.
Abbildungen der Decidua: Hunter, Anatomia uteri gravidi.
Tab. 33. 34. V elpeau, Embryologie. Paris 1833. S eiler, die
Gebärmutter und das E i des Menschen in den ersten Schwang er sekaftsmonaten.
Dresden 1832. K ilian, Geburtshülfl. Atlas Tab. X X IV .
C. Mayer, Icônes selectae. Bonn 1831. Tab. V. Fig. 6. 7. 8.
Die Entwickelung des Embryo, die Bildung des Amnions und
des Dottersacks erfolgen heim Menschen wahrscheinlich ebenso
wie hei den Vögeln. Das Naheibläschen und sein Gang haben
nämlich dieselbe Beziehung: zum Darm, wie der Dottersack und
Dottergang zum Darm beim Vogel. Daher ist das Nabelbläschen
dem Dottersack in Allem gleich zu achten. Dass der Stiel dieses
Bläschens auch hier mit dem Darm zusammenhängt, ist zur
Zeit, wo dieser Stiel dünn und lang ist, nicht mehr sicher zu
beweisen. K ieser (die Bildung des Darmcanals aus der Vesicula
umbilicalis. Gott. 1810.) sah diesen Stiel bis zum Darm verlaufen
und bildete es ab. Es wurde vielfach bestritten, der Stiel für
ein Blutgefäss erklärt. Hingegen ist der Beweis mit Sicherheit an
den jüngsten Embryonen zu führen. An Eiern, deren Embryo
2-—3 Linien lang ist, ist der Stiel des Nabelbläsehens ausserordentlich
kurz und weit, und die Wände dieser Basis des Nabelbläschens
gehen deutlich in die Wände der Uranlage des Darms
über. So sah ich den Zusammenhang an einem vor längerer Zeit
beschriebenen Ei (Archiv 1834. p. 8.). Aehnliche Beobachtungen
stellten W agner und Allen T homson an, und der letztere sah das
Nabelbläschen sogar in einem so frühzeitigen Zustande, dass es
ohne alle Einschnürung mit den Rändern der Carina des Embryo
zusammenhing. In einer mir von E. H. W eber mitgetheilten
Abbildung eines sehr jungen Embryo sind ausser dem Stiel des
Nabelbläschens auch dessen .Blutgefässe gesehen.
An den jüngern Eiern ist das Chorion von dem, den Fötus
noch eng umziehenden Amnion durch einen sehr grossen Zwischenraum
getrennt, welcher mit einer bald mehr dünnen, bald
mehr gallertigen Flüssigkeit, V elpeau’s Corps réticulé, gefüllt ist.
An der innern Wand des Chorions lässt sich leicht eine dünne
Hautschicht (Endochorion) ablösen, als wenn diese Flüssigkeit
oder Gallerte in einem eignen Sack eingeschlossen wäre. Zuweilen
finden sich in der Gallerte auch spinngewebeartige Fäden,
die mit jener innern Schichte des Chorions und dem Amnion
Zusammenhängen. Mehrere, wie in neuerer Zeit V elpeau, hielten
diese Substanz mit dem sie begrenzenden Häutchen für die
Allantois des Menschen, indem sie ungefähr zwischen Amnion,
Nabelblase und Chorion gelegen ist,, wie die Allantois der Säu-
gethiere. Es ist aber nie gelungen, diese Ansicht durch die
Genesis der Allantois zu erhärten und sie ist überhaupt unwahrscheinlich.
Vielmehr ist diese Masse als Eiweiss zu betrachten. Sehr
wahrscheinlich verhält sich die Allantois des Menschen ungefähr s"ö
wie bei den Nagern, d.h. sie erscheint nur als schmales, gegen
das Chorion sich verlängerndes Bläschen, und ist nur bestimmt
die Nabelgefässe zum Chorion zu bringen und diesem einzupflanzen.
Hieher sind dann die Beobachtungen zu rechnen, wo an sehr
jungen Embryonen zwei Bläschen mit Stielen aus dem Bauche
des Embryo hervorgingen. P ockels Isis 1825. Tab, 1 2 .13. Coste
Embryog. Tab. III, Fig. 4. 5. S eiler Taf. X. v. Baer’s Entwickelungsgeschichte
Tab. VI. Fig. 15. und 17. und in S iebold’s JournalXIV.
Mu l le r ’s Physiologie, Sr, Bd» III, 46