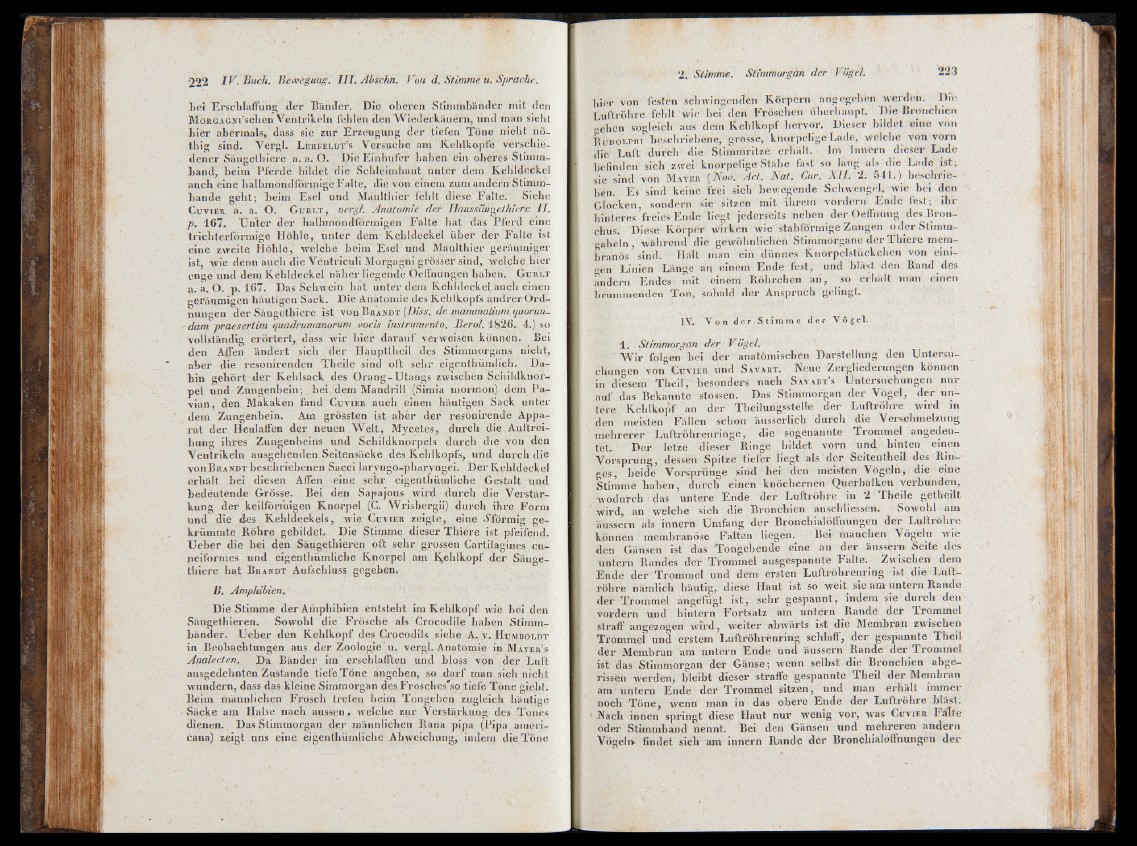
Lei Erschlaffung der Bänder. Die oberen Stimmbänder mit den
MoRGAGNi’schen Ventrikeln fehlen den Wiederkäuern, und man sieht
hier abermals, dass sie zur Erzeugung der tiefen Töne nicht nö-
thig sind. Vergl. L eheeldt’s Versuche am Kehlkopfe verschiedener
Säugethiere a. a. O. Die Einhufer haben ein oberes Stimmband,
beim Pferde bildet die Schleimhaut unter dem Kehldeckel
auch eine halbmondförmige Falte, die von einem zum andern Stimmbande
geht; beim Esel und Maulthier fehlt diese Falte. Siehe
Cuvier a. a. O. Gurlt, Oergl. Anatomie der Uaussiiugeihiere II.
p. 167. Unter der halbmondförmigen Falte hat das Pferd eine
trichterförmige Höhle, unter dem Kehldeckel über der Falte ist
eine zweite Höhle, welche beim Esel und Maulthier geräumiger
ist, wie denn auch die Ventriculi Morgagni grösser sind, welche hier
enge und dem Kehldeckel näher liegende Oeffnungen haben. Gurlt
a. a. O. p. 167. Das Schwein hat unter dem Kehldeckel auch einen
geräumigen häutigen Sack. Die Anatomie des Kehlkopfs andrer Ordnungen
der Säugethiere ist von Brandt {Diss. de mammalium (/uorun-
■ dam praeseriim cpiadrumanorum vocis instrumento. Berol. 1826. 4.) so
vollständig erörtert, dass wir hier darauf verweisen können. Bei
den Affen ändert sich der Haupttheil des Stimmorgans nicht,
aber die resonirenden Theile sind oft -sehr .eigentümlich. Dabin
gehört der Kehlsack des Orang-Utangs zwischen Schildknor-
pel und Zungenbein; bei/dem Mandrill (Simia mormon) dem Pavian,
den Makaken fand Cuvier auch einen häutigen Sack unter
dem Zungenbein. Am grössten ist aber der resrbniren.de .Appar
rat der Heulaffen der neuen Welt, Mycetes, durch die Auftreibung
ihres Zungenbeins und Schildknörpels durch die von den
Ventrikeln ausgehenden Seitensäcke des.Kehlkopfs, und durch die
von Brandt beschriebenen Saeci laryngo-pharyngei. Der Kehldeckel
erhält bei diesen Affen eine sehr eigenthümliche Gestalt und
bedeutende Grösse. Bei den Sapajous wird durch die Verstärkung
der keilförmigen Knorpel (C. Wrisbergii) durch ihre Form
und die des Kehldeckels, wie Cuvier zeigte, eine Aförmig gekrümmte
Röhre gebildet. Die Stimme dieser Thiere ist pfeifend.
Ueber die bei den Säugethieren oft sehr grossen Carlilagines cu-
neiformes und eigenthümliche Knorpel am I^ehlkopf der Säugethiere
hat Brandt Aufschluss gegeben.
B. Amphibien.'
Die Stimme der Amphibien entsteht im Kehlkopf wie bei den
Säugethieren. Sowohl die Frösche als Crocodile haben Stimmbänder.
Ueber den Kehlkopf des Crocodils siehe A. v. Humboldt
in Beobachtungen aus der Zoologie u. vergl. Anatomie in Mayer’s
Analecten. Da Bänder im erschlafften und bloss von der Luft
ausgedehnten Zustande tiefe Töne angeben, so darf man sich nicht
wundern, dass das kleine Simmorgan des Frosches’so tiefe Töne giebt.
Beim männlichen Frosch treten beim Tongeben zugleich häutige
Säcke am Halse nach aussen, welche zur Verstärkung des Tones
dienen. Das Stimmorgan der männlichen Räna pipa (Pipa ameri-
cana) zeigt uns eine eigenthümliche Abweichung, indem die Töne
hier von festen schwingenden Körpern angegeben W'erden. Die
Luftröhre fehlt wie bei den Fröschen überhaupt. Die Bronchien
gehen sogleich aus dem Kehlkopf hervor. Dieser bildet eine von
R udolphi beschriebene, grosse, knorpelige Lade, welche von vorn
die Luft durch die Stimmritze erhält. Im Innern dieser Lade
befinden sich zwei knorpelige Stäbe last so lang als die Lade ist;
sie sind von Mayer (I\W. Act. Nat. Gur. XII. 2. 541.) beschrieben.
Es sind keine frei sich bewegende Schwengel, wie bei den
Glocken, sondern sie sitzen mit ihrem vordem Ende fest; ihr
hinteres freies Ende liegt jederseits neben der Oeffuüng des Bronchus.
Diese Körper wirken wie stabförmige Zungen oder Stimmgabeln,
während die gewöhnlichen Stimmorgane der Thiere mem-
iiranös sind. Hält man ein dünnes Knorpelstückchen von einigen
Linien Länge an einem Ende fest, und bläst den Rand des
andern Endes' mit einem Röhrchen an, so erhält man einen
brummenden Ton, sobald der Anspruch gelingt.
IV. V o n d e r . S t im m e d e r V ö g e l .
1. Stimmorgan der Vögel.
Wir folgen bei der anatomischen Darstellung den Untersuchungen
von0 Cuvier u n d S avart. Neue Zergliederungen können
in diesem Theil, besonders nach S avart s Untersuchungen nur
auf das Bekannte stossen. Das Stimmorgan der Vögel, der untere
Kehlkopf an der Theilungsstelle der Luftröhre wird in
den meisten Fällen schon äusserlich durch die Verschmelzung
mehrerer Luftröhrenringe, die sogenannte Trommel angedeutet.
Der letze dieser Ringe bildet vorn und hinten einen
Vorsprung, dessen Spitze tiefer liegt als der Seitentheil des Ringes,
beide Vorsprünge sind bei den meisten Vögeln-, die eine
Stimme haben, durch einen knöchernen Querbalken verbunden,
wodurch das untere Ende der Luftröhre in 2 Theile geteilt
'wird, an welche sich die Bronchien anscbliessen. Sowohl am
äussern als innern Umfang der Bronchialöffnungen der Luftröhre
können membranöse Falten liegen. Bei manchen Vögeln wie
den Gänsen ist das Tongehende eine an der äussern Seite des
untern Randes der Trommel ausgespannte Falte. Zwischen dem
Ende der Trommel und dem ersten Luftröhrenring ist die Luftröhre
nämlich häutig, diese Haut ist so weit sie am untern Rande
der Trommel angefügt ist, sehr gespannt, indem sie durch den
vordem und hintern Fortsatz am untern Rande der Trommel
straff angezogen wird, weiter abwärts ist die Membran zwischen
Trommel und erstem Luftröhrenring schlaff, der gespannte Theil
der Membran am untern Ende und äussern Rande der Trommel
ist das Stimmorgan der Gänse; wenn selbst die Bronchien abgerissen
werden; bleibt dieser straffe gespannte Theil der Membran
am' untern Ende der Trommel sitzen, und man erhält immer
noch Töne, wenn man in das obere Ende der Luftröhre bläst.
1 Nach innen springt diese Haut nur wenig vor, was Cuvier Falte
oder Stimmband nennt. Bei den Gänsen und mehreren andern
Vögeln* findet sich am innern Rande der Bronchialöffnungen der