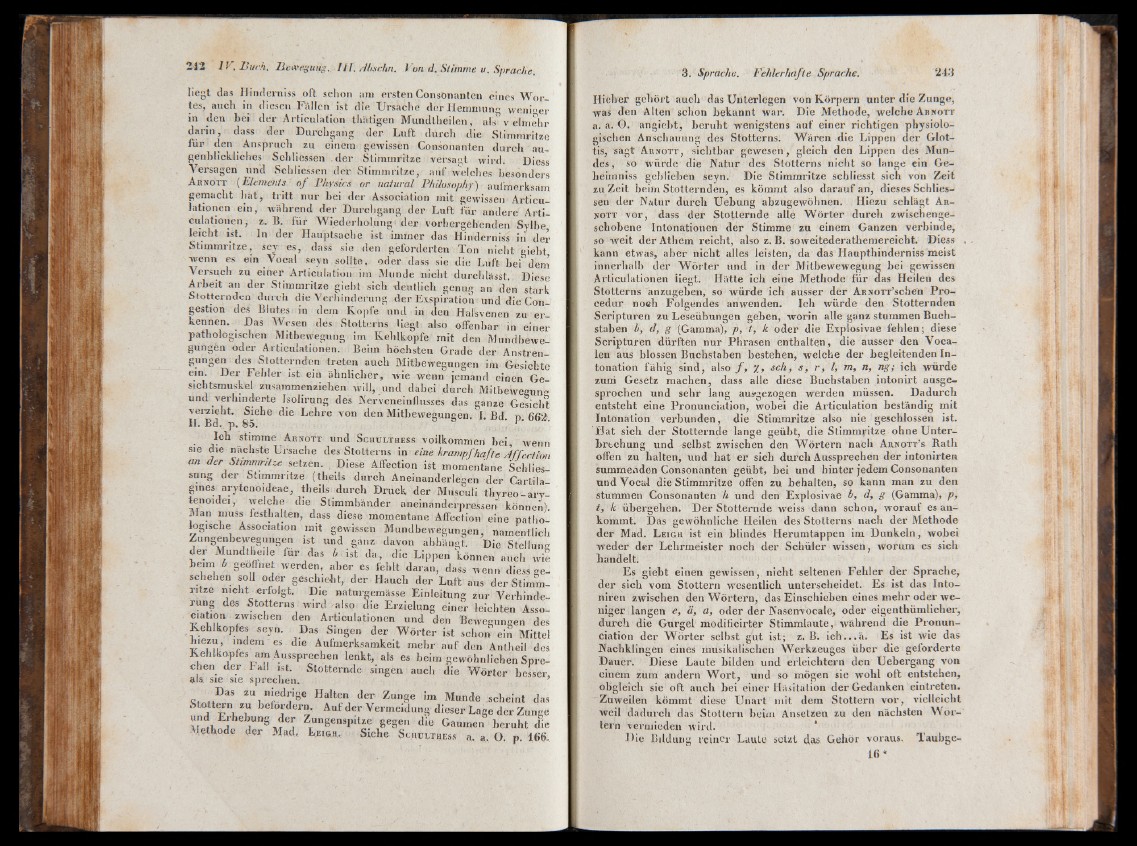
liegt das Hindernis? oft schon am ersten Consonanten eines Wortes,
auch in diesen Fallen ist die Ursache der Hemmung weniger
in den hei der Articulation thätigen Mundtheilen, als v elmehr
darin, dass der Durchgang der Luft durch die Stimmritze
für den Anspruch zu einem geivissen Consonanten durch augenblickliches
Schliessen der Stimmritze versagt wird. Diess
Versagen und Schliessen der Stimmritze, auf welches besonders
A knott [Elements- of Physics or natural Philosoph.y) aufmerksam
gemacht hat, tritt nur hei der Association mit gewissem Articu-
lationen ein, während der Durchgang der Luft für andere Articulationen
j z. B. für Wiederholung1 der vorhergehenden Sylbe
leicht ist. ln der Hauptsache ist immer das Hindernis? in der
Stimmritze, sey es, dass sie den geforderten Ton nicht giebt
wenn es ein Vocal seyn sollte, oder dass sie die Luft- hei" dem
Versuch zu einer Articulation im Munde nicht durchlässt. Diese
Arbeit an der Stimmritze giebt sich -deutlich genug an den stark
Stotternden durch die Verhinderung der Exspiration und die Con-
gestion des Blutes in dem Kopfe und in den Halsvenen zu erkennen.
Das Wesen des Stotterns liegt also offenbar in einer
pathologischen Mitbewegung im Kehlkopfe mit den Mundbewe-
gungèn oder Articulationen. Beim höchsten Grade der Anstrengungen
des Stotternden treten auch Mitbewegungen im Gesichte
ein. Der Fehler ist ein ähnlicher, vvie wenn jemand einen Gesichtsmuskel
zusammenziehen will, und dabei durch Mitbeweaurm
und verhinderte Isolirung des Nerveneinflusses das ganze Gesicht
verzieht. Siehe die Lehre von den Mitbewegungen. I. Bd. p 662-
H. Bd, p. 85. * ' '
Ich stimme Arnott und Schulthess vollkommen bei, wenn
sie die nächste Ursache des Stotterns in eine krampfhafte Affection
an der Stimmritze setzen. , Diese Affection ist momentane Schlies
sung der Stimmritze (theils durch Aneinanderlegen der Cartila-
gines arytenoideae, theils durch Druck der Musculi thyreo-ary-
tenoidei, welche die Stimmbänder aneinanderpressen können).
Man muss festhalten, dass diese momentane Affection eine pathologische
Association mit gewissen Mundbewegungen,' namentlich
Zungenbewegungen ist und ganz davon abhängt. Die Stellung
der Mundtbeile für das b, ist da, die Lippen können auch wie
beim b geöffnet werden, aber es fehlt daran, dass wenn diess geschehen
soll oder geschieht, der Hauch der Luft aus der Stimmritze
nichF erfolgt. Die »aturgemässe Einleitung zur Verhinderung
des Stotterns wird also die Erzielung einer leichten Asso-
ciation zwischen den Articulationen und den Bewegungen des
Kehlkopfes seyn. Das Singen der Wörter ist schon ein Mittel
hiezu, indem es die Aufmerksamkeit mehr auf den Antheil des
Kehlkopfes am Aussprechen lenkt, als es beim gewöhnlichen Sprechen
der I ad ist. Stotternde singen auch die Wörter besser
ftlft sie sie sprechen. ' *
Das zu niedrige Halten der Zunge im Munde scheint das
Stottern zu befördern. Auf der Vermeidung dieser Lage der Zunge
und Erhebung der Zungenspitze gegen die Gaumen beruht die
lethode der Mad, Leich. Siehe S c.hülthess g, O. p. 166..
Hielier gehört auch das UiiterlCgen von Körpern unter die Zunge,
was den Alten schon bekannt war. Die Methode, welche Abbott
a. a. 0 . angiebt, beruht wenigstens auf einer richtigen physiologischen
Anschauung des Stotterns. Wären die Lippen der Glottis,
sagt Arnott, sichtbar gewesen, gleich den Lippen des Mundes,
so würde die Natur des Stotterns nicht so lange ein Ge-
heimniss geblieben seyn. Die Stimmritze schliesst sich von Zeit
zu Zeit beim Stotternden, es kömmt also darauf an, dieses Schliessen
der Natur durch Uebung abzugewöhnen. Hiezu schlägt Ar-
uoTT vor, dass der Stotternde alle Wörter durch zwischengeschobene
Intonationen der Stimme zu einem Ganzen verbinde,
so weit der Athem reicht, also z. B. soweitederathemereicht. Diess
kann etwas, aber nicht alles leisten, da das Haupthinderniss meist
innerhalb der Wörter und in der Mitbewewegung bei gewissen
Articulationen liegt. Hätte ich eine Methode für das Heilen des
Stotterns anzugeben, so würde ich ausser der ARNOTT’schen Pro-
cedur noeh Folgendes anwertden. Ich würde den Stotternden
Scripturen zu Leseübungen geben, worin alle ganz stummen Buchstaben
b, d, g (Gamma), p, t, k oder die Explosivae fehlen; diese
Scripturen dürften nur Phrasen enthalten, die ausser den Voca-
len aus blossen Buchstaben bestehen, welche der begleitenden Intonation
fähig sind, also f , %, sch, s , r , l, m, n, ng; ich würde
zuni Gesetz machen, dass alle diese Buchstaben intonirt ausgesprochen
und sehr lang ausgezogen werden müssen. Dadurch
entsteht eine Pronunciation, wobei die Articulation beständig mit
Intonation verbunden, die Stimmritze also nie geschlossen ist.
Hat sich der Stotternde lange geübt, die Stimmritze ohne Unterbrechung
und selbst zwischen den Wörtern nach Arnott’s Rath
offen zu halten, und hat er sich durch Aussprechen der intonirten
summenden Consonanten geübt, bei und hinter jedem Consonanten
und Vocal die Stimmritze offen zu behalten, so kann man zu den
stummen Consonanten h und den Explosivae b, d, g (Gamma), p,
t, k übergehen. Der Stotternde weiss dann schon, worauf es ankommt.
Das gewöhnliche Heilen des Stotterns nach der Methode
der Mad. L eigh ist ein blindes Herumtappen im Dunkeln, wobei
weder der Lehrmeister noch der Schüler wissen, worum es sich
handelt.
Es giebt einen gewissen, nicht seltenen Fehler der Sprache,
der sich vom Stottern wesentlich unterscheidet. Es ist das Into-
niren zwischen den Wörtern, das Einschieben eines mehr oder weniger
langen e, ä, a, oder der Naserrvocale, oder eigentümlicher,
durch die Gurgel modificirter Stimmlaute,: während die Pronunciation
der Wörter selbst gut ist; z. B. ich...ä. Es ist wie das
Nachklingen eines musikalischen Werkzeuges über die geforderte
Dauer. Diese Laute bilden und erleichtern den Uebergang von
einem zum andern Wort, und so mögen sie wohl oft entstehen,
obgleich sie oft auch bei einer Häsitation der Gedanken eintreten.
Zuweilen kömmt diese Unart mit dem Stottern vor, vielleicht
weil dadurch das Stottern beim Ansetzen zu den nächsten Wörtern
vermieden wird.
Die Bildung reiner Laute setzt das Gehör voraus. Taubge