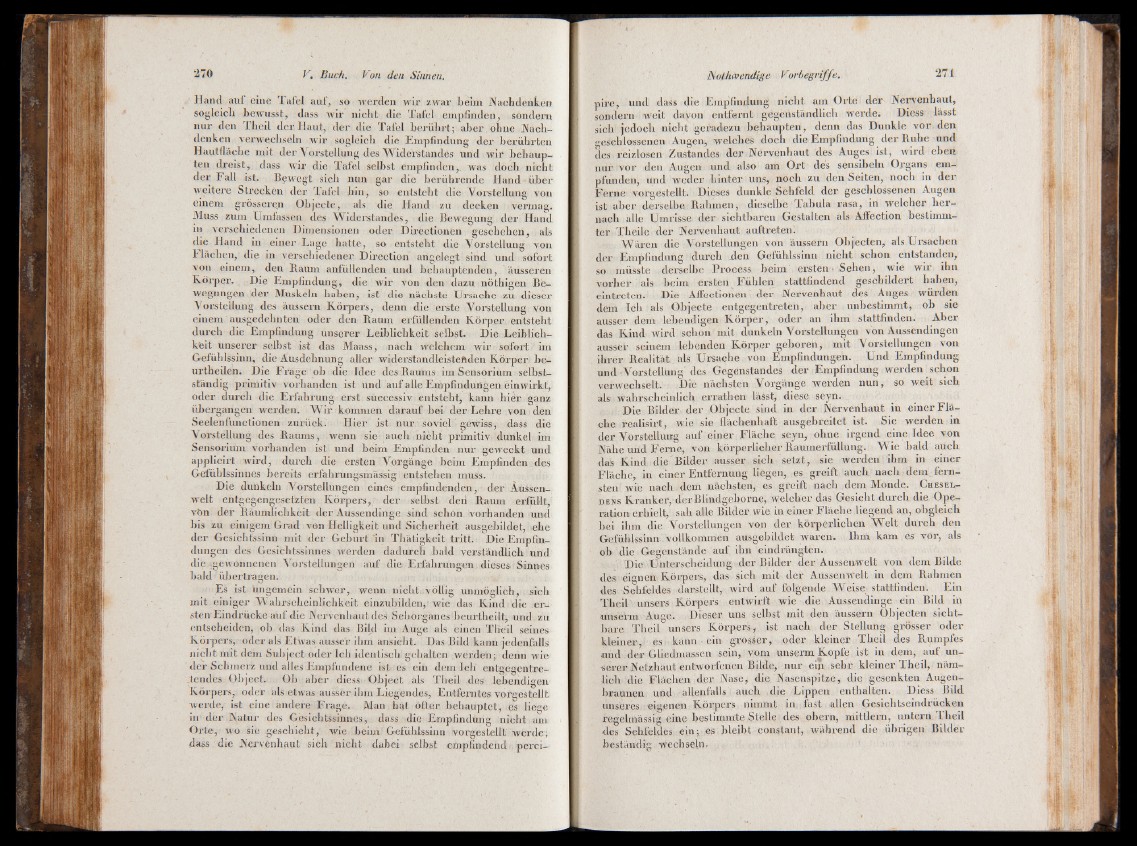
Hand aui eine Tafel auf, so werden wir zwar Leim Nachdenken
sogleich bewusst, dass wir nicht die Tafel empfinden, sondern
nur den Theil der Haut, der die Tafel berührt; aber , ohne Nachdenken
verwechseln wir sogleich die Empfindung der berührten
Hautflache mit der Vorstellung des Widerstandes und wir behaupten
dreist, dass wir die Tafel selbst empfinden, was doch nicht
der Fall ist. Bewegt sich nun gar die berührende Hand über
weitere Strecken der Tafel bin, so entsteht die Vorstellung von
einem grossereen Objecte, als die Hand zu decken vermag.
Muss zum Umfassen des Widerstandes, die Bewegung der Hand
in verschiedenen Dimensionen oder Directionen geschehen, als
die Hand in einer Lage hatte, so entsteht die Vorstellung von
Hachen, die in verschiedener Direction angelegt sind und sofort
von einem, den Baum anfüllenden und behauptenden, äusseren
Körper. Die Empfindung, die wir von den dazu nöthigen Bewegungen
der Muskeln haben, ist die nächste Ursache zu dieser
Vorstellung des äussern Körpers, denn die erste Vorstellung von
einem ausgedehnten oder den Baum erfüllenden Körper entsteht
durch die Empfindung unserer Leiblichkeit selbst. Die Leiblichkeit
unserer selbst ist das Maass, nach welchem wir sofort im
Gefühlssinn, die Ausdehnung aller widerstandleisteftden Körper be-
urtheilen. Die Frage ob die Idee des Raums im Sensorium selbstständig
primitiv vorhanden ist und auf alle Empfindungen, einwirkt,
oder durch die Erfahrung erst suecessiv entsteht, kann hier ganz
übergangen werden. Wir kommen darauf bei der Lehre von den
Seelenfunctionen zurück. Hier ist nur soviel gewiss, dass dié
Vorstellung des Raums, wenn sie auch nicht primitiv dunkel im
Sensorium vorhanden ist und beim Empfinden nur geweckt und
applicirt wird, durch die ersten Vorgänge beim Empfinden des
Gefühlssinnes bereits erfahrungsmässig entstehen muss.
Die dunkeln Vorstellungen eines empfindenden, der Aussen-
welt entgegengesetzten Körpers,' der selbst den Raum erfüllt,
vön der Räumlichkeit der Aussendinge sind schon vorhanden und
bis zu einigem Grad von Helligkeit und Sicherheit ausgebildet, ehe
der Gesichtssinn mit der Geburt 'in Thätigkeit tritt. Die Empfindungen
des Gesichtssinnes werden dadurch bald verständlich und
die^gewonnenen Vorstellungen auf die Erfahrungen dieses Sinnes
bald übertragen..
Es ist üngemein schwer, wenn nicht, völlig unmöglich, sich
mit einiger Wahrscheinlichkeit einzubilden, wie das Kind die ersten
Eindrücke auf die Nervenhaut des Sehorganes beurtheilt, und zu
entscheiden, ob das Kind das Bild im Auge als einen Theil seines
Körpers, oder als Etwas ausser ihm ansieht. Das Bild kann jedenfalls
nicht mit dem Subject oder Ich identisch gehalten werden; denn wie
der Schmerz und alles Empfundene ist es ein dem Ich entgegentre-
.tendes Object. Ob aber diess Object als Theil des lebendigen
Körpers, oder als etwas ausser ihm Liegendes, Entferntes vorgestellt
werde, ist eine andere Frage. Man hat öfter behauptet, és liege
in der Natur des Gesichtssinnes, dass die Empfindung nicht am
Orte, wo sie geschieht, wie beim Gefühlssinn vorgestellt werde;
dass die Nervenhaut sich nicht dabei selbst empfindend percipire,
und dass die Empfindung nicht am Orte der Nervenbaut,
sondern weit davon entfernt gegenständlich werde. Diess lässt
sich jedoch nicht g e ra d e z u behaupten, denn das Dunkle vor den
geschlossenen Augen, welches doch die Empfindung der Ruhe und
des reizlosen Zustandes der Nervenhaut des Auges ist, wird eben
nur vor den Augen und also am Ort des sensibeln Organs empfunden,
und weder hinter uns, noch zu den Seiten, noch in der
Ferne vorgestellt. Dieses dunkle Sehfeld der geschlossenen Augen
ist aber derselbe Rahmen, dieselbe Labula rasa, in welcher hernach
alle Umrisse der sichtbaren Gestalten als Affection bestimmter
Tlieile der Nervenhaut auftreten.
Wären die Vorstellungen von äussern Objecten, als Ursachen
der Empfindung durch Ren Gefühlssinn nicht schon entstanden,
so müsste derselbe Process, beim ersten > Sehen, wie wir ihn
vorher als beim ersten Fühlen stattfindend geschildert haben,
eintreten. Die Affectiorien der Nervenhaut des Auges würden
dem Ich als Objecte entgegentreten, aber unbestimmt, ob sie
ausser dem lebendigen Körper, oder an ihm stattfinden. Aber
das Kind wird schon mit dunkeln Vorstellungen von Aussendingen
ausser seinem lebenden Körper geboren, mit Vorstellungen von
ihrer Realität , als Ursache von Empfindungen. Und Empfindung
und Vorstellung des Gegenstandes der Empfindung werden schon
verwechselt. Die nächsten Vorgänge werden nun, so weit sich
als wahrscheinlich errathen lässt, diese seyn. n
Die Bilder der Objecte sind in der Nervenhaut in einer Fläche
realisirt, wie sie flächenhaft ausgebreitet ist. Sie werden in
der Vorstellung auf einer Fläche seyn, ohne irgend eine Idee von
Nähe und Ferne, von körperlicher Raumerfüllung. Wie bald auch
das Kind die Bilder ausser sich setzt, sie werden ihm in einer
Fläche, in einer Entfernung liegen, es greift auch nach dem fernsten
wie nach dem nächsten, es greift nach dem Monde. C h e s e l -
dens Kranker, derBIindgehorne, welcher das Gesicht durch die Operation
erhielt, sah alle Bilder wie in einer Fläche liegend an, obgleich
bei ihm die Vorstellungen von der körperlichen Welt diu-ch den
Gefühlssinn vollkommen ausgebildet waren. Ihm kam es vor, als
ob die Gegenstände auf ihn eindrängten.
Die Unterscheidung der Bilder der Aussenwelt von dem Bilde
des eignen Körpers, das sich mit der Aussenw'elt in dem Rahmen
des Sehfeldes darstellt, wird auf folgende Weise stattfinden. Ein
Theil unsers Körpers entwirft wie die Aussendinge ein Bild in
unserin Auge. Dieser uns selbst mit den äussern Objecten sichtbare
Theil unsers Körpers? ist nach der Stellung grösser oder
kleiner, es kann ein grosser, oder kleiner Theil des Rumpfes
und der Gliedmassen sein, vom unserm Kopfe ist in dem, auf unserer
Netzhaut entworfenen Bilde, nur eip sehr kleiner Theil, nämlich
die Flächen der Nase, die Nasenspitze, die gesenkten Augenbraunen
und allenfalls auch die Lippen enthalten. Diess Bild
unseres eigenen Körpers nimmt in fast allen Gesichtseindrücken
regelmässig eine bestimmte Stelle des obern, mittlern, untern Theil
des Sehfeldes ein; es bleibt constant, während die übrigen Bilder
beständig wechseln.