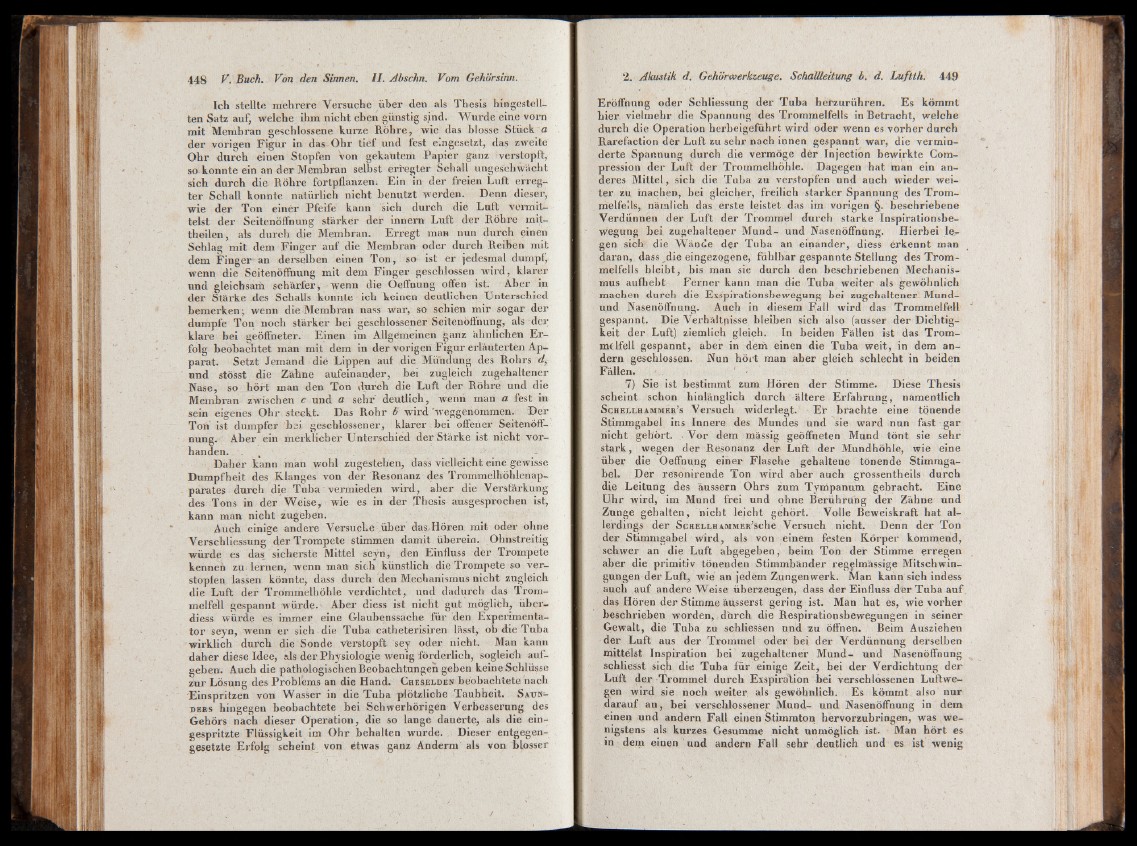
Ich stellte mehrere Versuche über den als Thesis hingestellten
Satz auf, welche ihm nicht eben günstig sind. Wurde eine vorn
mit Membran geschlossene kurze Röhre, wie das blosse Stück a
der vorigen Figur in das-Ohr tief und fest eingesetzt, das zweite
Ohr durch einen Stopfen von gekautem Papier ganz verstopft,
so konnte ein an der Membran selbst erregter Schall ungeschwächt
sich durch die Röhre fortpflanzen; Ein in der freien Luft erregter
Schall konnte natürlich nicht benutzt werden. Denn dieser,
wie der Ton einer Pfeife kann sich durch die Luft vermittelst
der Seitenöffnung stärker der innern Luft der Röhre mittheilen,
als durch die Membran. Erregt man nun durch c:inen
Schlag mit dem Finger auf die Membran oder durch Reihen mit
dem Finger-an derselben einen Ton, so ist er jedesmal dumpl,
wenn die Seitenöffnung mit dem Finger geschlossen wird, klarer
und gleichsarh schärfer; wenn die Oeffnung offen ist. Aber in
der Stärke des Schalls konnte ich keinen deutlichen Unterschied
bemerken ; wenn die Membran nass war, so schien mir sogar der
dumpfe Ton noch stärker bei geschlossener Seitenöffnung, als der
klare bei geöffneter. Einen im Allgemeinen ganz ähnlichen Erfolg
beobachtet man mit dem in der vorigen Figur erläuterten Apparat.
Setzt Jemand die Lippen auf die Mündung des Rohrs d,
und stösst die Zähne aufeinander, bei zugleich zugehaltener
Nase, so hört man den Ton durch die Luft der Röhre und die
Membran zwischen c und a sehr deutlich, wenn man a fest in
sein eigenes Ohr steckt. Das Rohr 6 wird 'weggenommen. Der
Ton ist dumpfer bei geschlossener, klarer bei offener Seitenöffnung.
Aber ein merklicher Unterschied der Stärke ist nicht vorhanden.
Daher kann man wohl zugestehen, dass vielleicht eine gewisse
Dumpfheit des Klanges von der Resonanz des Trommelhöhlenapparates
durch die Tuba vermieden wird, aber die Verstärkung
des Tons in der Weise, wie es in der .Thesis ausgesprochen ist,
kann man nicht zugeben.
Auch einige andere Versuche über das,Hören mit oder ohne
Verschliessung der Trompete stimmen damit überein. Ohnstreitig
würde es das sicherste Mittel seyn, den Einfluss der Trompete
kennen zu lernen, wenn man sic h künstlich die Trompete so verstopfen
lassen könnte, dass durch den Mechanismus nicht zugleich
die Luft der Trommelhöhle verdichtet, und dadurch das Trommelfell
gespannt würde. Aber diess ist nicht gut möglich, über-
diess würde es immer eine Glaubenssache für den Experimentator
seyn, wenn er sich die Tuba catheterisiren lässt, ob die Tuba
wirklich durch die Sonde verstopft sey oder nicht. Man kann
daher diese Idee, als der Physiologie wenig förderlich, sogleich aufgeben.
Auch die pathologischen Beobachtungen geben keine Schlüsse
zur Lösung des Problems an die Hand. Cheselden beobachtete nach
'Einspritzen von Wasser in die Tuba plötzliche Taubheit. Saun-
debs hingegen beobachtete hei Schwerhörigen Verbesserung des
Gehörs nach dieser Operation, die so lange dauerte, als die eingespritzte
Flüssigkeit im Ohr behalten wurde. Dieser entgegengesetzte
Erfolg scheint von etwas ganz Anderm als von blosser
Eröffnung oder Schliessung der Tuba herzurühren. Es kömmt
hier vielmehr die Spannung des Trommelfells in Betracht, welche
durch die Operation herbeigeführt wird oder wenn es vorher durch
Rarefaction der Luft zu sehr nach innen gespannt war, die verminderte
Spannung durch die vermöge dér Injectibn bewirkte Com-
pression der Luft der Trommelhöhle. Dagegen hat man ein anderes
Mittel, sich die Tuba zu verstopfen und auch wieder weiter
zu machen, bei gleicher, freilich starker Spannung des Trommelfells,
nämlich das erste leistet das im vorigen §. beschriebene
Verdünnén der Luft der Trommel durch starke Inspirationsbewegung
bei zugehaltener Mund- und Nasenöffnüng. Hierbei legen
sicK die Wände der Tuba an einander, diess érkennt man
daran, dass die eingezogene, fühlbar gespannte Stellung des Trommelfells
bleibt, bis man sie durch den beschriebenen Mechanismus
aufhebt Ferner kann man die Tuba weiter als gewöhnlich
machen durch die Exspirationsbewegung bei zugebaltener Mund-
und Nasenöffnung. Auch in diesem Fall wird das Trommelfell
gespannt. Die Verhältnisse bleiben sich also (ausser der Dichtigkeit
der Luft) ziemlich gleich. In beiden Fällen ist das Trommelfell
gespannt, aber in dem einen die Tuba weit, in dem andern
geschlossen. Nun hört- man aber gleich schlecht in beiden
Fällen! ' .
7) Sie ist bestimmt zum Hören der Stimme. Diese Thesis
scheint schon hinlänglich durch ältere Erfahrung, namentlich
Schellhammer’s Versuch widerlegt. Er brachte eine tönende
Stimmgabel ins Innere des Mundes und sie ward nun fast gar
nicht gehört. ■ Vor dem massig geöffneten Mund tönt sie sehr
stark, wegen der Resonanz der Luft der Mundhöhle, wie eine
über die Oeffnung einer Flasche gehaltene tönende Stimmgabel.
Der resonirende Ton wird aber auch grossentheils durch
die Leitung des äussern Ohrs Zum Tynipänum gebracht. Eine
Uhr wird, im Mund frei und ohne Berührung der Zähne Und
Zunge gehalten, nicht leicht gehört. Volle Beweiskraft hat allerdings
der SeaELLHAMMER’sche Versuch nicht. Denn der Ton
der Stimmgabel wird, als von einem festen Körper kommend,
schwer an die Luft abgegeben, beim Ton der Stimme erregen
aber die primitiv tönenden Stimmbänder regelmässige Mitschwingungen
der Luft, wié an jedem Zungenwerk. Man kann sich indess
auch auf andere Weise überzeugen, dass der Einfluss d'ër Tuba auf
das Hören der Stimme äüsserst gering ist. Man hat es, wie vorher
beschrieben worden,. dbreh die Respiratiöpsbewegungen in seiner
Gewalt, die Tuba zu schliessen und zu öffnen. Beim Ausziehen
der Luft aus der Trommel oder bei. der Verdünnung derselben
mittelst Inspiration bei zugehaltener Mund- und Nasenöffnung
schliésst sich die Tuba für einige Zeit, bei der Verdichtung der
Luft der -Trommel durch Exspiration bei verschlossenen Luftwegen
wird sie noch weiter als gewöhnlich. Es kömmt also nur
darauf an, bei verschlossener Mund- und Nasenöffnung in dem
einen und andern Fall einen Stimmton hervorzubringen, was wenigstens
als kurzes Gesumme nicht unmöglich ist. Man hört es
in dem einen und andern Fall sehr deutlich und es ist wenig